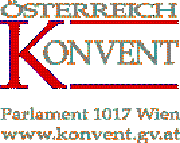
26. März 2004
Bericht des Ausschusses 9
Rechtsschutz und Gerichtsbarkeit
Der Österreich-Konvent hat dem Ausschuss 9 die folgenden Themenbereiche zur Vorberatung zugewiesen:
Einrichtung eines effizienten und effektiven Rechtsschutzes unter
dem Gesichtspunkt bürgerinnen- und bürgernaher Entscheidungen: Ordentliche
Gerichtsbarkeit, Gerichtshöfe öffentlichen Rechts, Verwaltungsgerichtsbarkeit
in den Ländern, Sondersenate.
Im Einzelnen ergeben sich dazu folgende Fragestellungen:
I) Allgemein
Gerichtsbarkeit – Struktur- und Systemfragen
II) Ordentliche Gerichtsbarkeit
1) Gerichtsorganisation
2) Neuorganisation (OGH – OLG – Eingangsgerichte?)
3) Fragen zur Staatsanwaltschaft
4) Entfall der Mitkompetenz der Landesregierungen bei Sprengeländerungen der
Gerichte?
III) Gerichtshöfe öffentlichen Rechts
1) Verhältnis der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts zueinander
2) Problembereiche (zB Verwaltungsgerichtshof ® Belastung)
3) Mitwirkungsrechte der Länder bei Bestellung der Spitzen und der Zusammensetzung
4) Bestellungsvorgang – Transparenz – Hearing
5) Kostentragung
IV) Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern
1) Problemstellung – Kompetenzen, Instanzenzug
2) Kostentragung
V) Sondersenate:
Art 133 Z 4 B-VG – Behörden, UVS und UBAS sowie unabhängige Behörden, die
primär mit der Rechtskontrolle betraut sind (Koordinierung mit Ausschuss 7)
VI) Rechtsschutz – Erweiterung?
Zeitplan:
Der Ausschuss hat dem Präsidium spätestens 4 Monate nach seiner konstituierenden Sitzung am 31.10.2003 einen schriftlichen Bericht (zumindest einen Teilbericht; gegebenenfalls mit Textvorschlägen für eine neue Verfassung) über die Ergebnisse der Beratungen vorzulegen.
Mitglieder des Ausschusses und deren Vertretung:
Univ.-Prof. Dr. Herbert Haller (Vorsitzender)
Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner (stellvertretender Vorsitzender)
Maga. Renate Brauner (fallweise vertreten durch Dr. Kurt Stürzenbecher
fallweise vertreten durch Gerhard Neustifter)
Univ.-Prof. Dr. Bernd-Christian Funk (fallweise begleitet von Maga. Gerda Marx)
BM Elisabeth Gehrer (fallweise vertreten durch Mag. Heribert
Donnerbauer)
Univ.-Prof. DDr. Christoph Grabenwarter
Univ.-Prof. Dr. Gerhart Holzinger
Univ.-Prof. Dr. Karl Korinek (fallweise begleitet von Maga. Andrea Martin)
DDr. Karl
Lengheimer
Dr. Johann Rzeszut (fallweise begleitet von Dr. Gerhard Kuras)
Dr. Johannes Schnizer
Maga. Terezija Stoisits (fallweise begleitet/vertreten von Mag. Thomas Sperlich)
Seitens des Büros des Österreich-Konvents wurde der Ausschuss von Dr. Gert Schernthanner betreut.
In seiner Sitzung vom 16.12.2003 hat der Ausschuss seinen Beratungen folgende externe Experten beigezogen:
Dr. Barbara Helige, Präsidentin der Österreichischen Richtervereinigung
Dr. Wolfgang Fellner, Sektionschef der Präsidialsektion im BM für Justiz
(mit Mag. Peter Hadler, Leiter der Abteilung Pr 1 im BM für Justiz)
Dr. Klaus Schröder, Vorsitzender der Bundessektion Richter und Staatsanwälte in
der Gewerkschaft öffentlicher Dienst
Dr. Wolfgang Swoboda, Präsident der Vereinigung Österreichischer Staatsanwälte
Dr. Walter Presslauer, Generalprokurator.
In seiner Sitzung vom 28.1.2004 hat der Ausschuss seinen Beratungen folgende – weitere – externe Experten beigezogen:
Dr. Helmut Hubner, Präsident des Oberlandesgerichts Linz
Dr. Gerhard Benn-Ibler, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags
Dr. Bernhard Frizberg, Vizepräsident der Österreichischen Notariatskammer
(mit Dr. Christian Sonnweber, Geschäftsführer der Österreichischen Notariatskammer)
Mag. Gero Schmied, Mitglied des UVS Wien und Vorsitzender der Vereinigung der
Mitglieder der UVS
Dr. Hans Linkesch, Präsident des UVS Oberösterreich und Vorsitzender der
Konferenz der Präsidenten und Vizepräsidenten der UVS.
Darüber hinaus wurde im Zusammenhang mit der diskutierten Einführung der Landesverwaltungsgerichtsbarkeit von der Ausschussbetreuung – auf der Grundlage der einschlägigen Vorarbeiten von Grabenwarter in Korinek/Holoubek, Kommentar zum B-VG (Loseblattsammlung), und Lanner, Kodex Verfassungsrecht, 19. Auflage, 2003 – eine aktualisierte Liste über die derzeit bestehenden Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag und die sonstigen weisungsfreien Verwaltungsbehörden ausgearbeitet und mit Schreiben vom 23.12.2003 an das Bundeskanzleramt/Verfassungsdienst (für den Bundesbereich) und an alle Ämter der Landesregierungen (für die jeweiligen Länder) mit der Bitte um Durchsicht und allfällige Ergänzung versendet. Es haben alle angeschriebenen Ämter geantwortet und – zum Teil umfangreiche – ergänzende Stellungnahmen erstattet. Diese Stellungnahmen wurden in der Zwischenzeit von der Ausschussbetreuung in die Liste eingearbeitet, die nunmehr – vollständig ergänzt und aktualisiert – diesem Bericht am Ende (als Punkt „C. Anhang“) angeschlossen ist und als Grundlage für zukünftige Diskussionen dienen könnte.
Der Ausschuss hat sich am 31.10.2003 konstituiert und die Themen, die sich aus dem vom Präsidium erteilten Mandat ergeben, in insgesamt elf Sitzungen – sieben Sitzungen des Ausschusses und vier Sitzungen der zum Generalthema „Einführung der (Landes-) Verwaltungsgerichtsbarkeit“ gebildeten, so genannten „kleinen Arbeitsgruppe“ – beraten.
Motto:
„In der Fülle verfassungsfremden Stoffes gingen die Umrisse der tragenden Ordnung verloren; barocke Stuckatur überzog den ursprünglichen Bau.
Verfassungsschöpfung aber beginnt damit, dass sie Kontraste schafft, dass sie herausfordernde Bilder prägt und damit Ziele setzt und Wege zur praktischen Handlung öffnet.“
Max Imboden in: Verfassungsrevision als Weg in die
Zukunft, 1966
A. Allgemeiner Teil
Über das bei den Beratungen des Ausschusses 9 erzielte Ergebnis wird der nachstehende Bericht erstattet. Dazu wird Folgendes vorausgeschickt:
Die Gliederung des Berichts entspricht der des - dem Ausschuss erteilten - Mandats. Neben den ausdrücklich im Mandat enthaltenen Punkten hat es der Ausschuss - einem vom stellvertretenden Ausschussvorsitzenden in der konstituierenden Sitzung erstatteten Vorschlag folgend – als zweckmäßig angesehen, auch den Bereich des präventiven Rechtsschutzes durch Beiräte und Rechtsschutzbeauftragte im Ausschuss zu behandeln.
Im Sinne des ihm erteilten Mandats hat der Ausschuss die im Mandat angeführten Themen (bzw Subthemen) dahingehend geprüft, ob ein bundesverfassungsgesetzlicher Änderungsbedarf gegeben ist und - bejahendenfalls - welche Reformoptionen dafür bestehen; so weit möglich hat der Ausschuss konkrete Formulierungsvorschläge ausgearbeitet.
Der Bericht gibt das Ergebnis der Beratungen im Ausschuss zu den einzelnen von diesem behandelten Themen wieder: Soweit dabei kein Konsens erzielt werden konnte, erachtete es der Ausschuss als zweckmäßig und auch für die weitere Arbeit im Präsidium bzw. im Plenum des Österreich-Konvents förderlich, die unterschiedlichen Positionen sowie die dafür jeweils ins Treffen geführten Argumente zu dokumentieren, um auf diese Weise einen Beitrag zur künftigen Konsensfindung zu leisten.
Bei manchen vom Ausschuss zu behandelnden Fragen hat sich in den Beratungen herausgestellt, dass eine abschließende Meinungsbildung vom Ergebnis der Beratungen in anderen Ausschüssen, deren Beratungen noch nicht abgeschlossen sind, abhängt. In diesen Fällen hat sich der Ausschuss bemüht, zumindest eine vorläufige Position zu formulieren. Der Ausschuss geht diesbezüglich - die Zustimmung des Präsidiums vorausgesetzt - davon aus, dass er seine Beratungen zu diesen Fragen zu gegebener Zeit wieder aufnehmen und abschließen wird. Des weiteren möchte der Ausschuss seine Bereitschaft zum Ausdruck bringen, sich zu einem späteren Zeitpunkt mit bisher noch nicht behandelten Themen sowie - gegebenenfalls aufbauend auf die dazu erfolgenden Beratungen im Präsidium des Österreich-Konvents - mit einzelnen Themen des Mandats, zu denen noch kein Konsens erzielt werden konnte bzw. zu denen mehrere Varianten vorgelegt worden sind, erneut zu befassen. Diese Bereitschaft besteht umso mehr, als sämtliche Ausschussmitglieder (und deren Vertreter) sehr sachlich und konstruktiv an den bisherigen Sitzungen des Ausschusses und der „kleinen Arbeitsgruppe“ mitgearbeitet haben und das von allen Seiten gezeigte ernsthafte Bemühen um sachgerechte Ergebnisse eine Fortsetzung der Beratungen sinnvoll und lohnend erscheinen lässt.
Abgesehen davon hat sich auch bei anderen vom Ausschuss zu behandelnden Fragen herausgestellt, dass sie mit Themen zusammenhängen, die vom Mandat anderer Ausschüsse erfasst sind. Darauf wird im Bericht jeweils ausdrücklich aufmerksam gemacht.
Der vom Vorsitzenden des Ausschusses verfasste Bericht ist vom Bemühen getragen, die in den Beratungen jeweils vertretenen - sei es auch unterschiedlichen - Positionen wiederzugeben und somit abweichende Stellungnahmen einzelner Ausschussmitglieder – nach Möglichkeit – entbehrlich zu machen.
I) Allgemein
I) 1) Zum Modell eines „Rats der Gerichtsbarkeit“
Der von der richterlichen
Standesvertretung erstattete und hauptsächlich in den Ausschusssitzungen am
16.12.2003 und 12.2.2004 diskutierte Vorschlag nach Einführung eines „Rats der
Gerichtsbarkeit“ zielt auf die Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit
als der dritten Staatsgewalt (neben der Legislative und der Exekutive) ab[1].
Danach solle ein so genannter „Rat der Gerichtsbarkeit“ geschaffen und von
insgesamt 24 Mitgliedern (Bundespräsident oder Nationalratspräsident als
Vorsitzender, Bundesminister für Justiz, die Präsidenten des Obersten
Gerichtshofs, des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags und der
Österreichischen Notariatskammer, je ein Mitglied jeder der [derzeit vier] im
Nationalrat vertretenen Parteien sowie 15 Richter) gebildet werden. Diesem „Rat
der Gerichtsbarkeit“ solle nach den Vorstellungen der richterlichen
Standesvertretung sowohl die Personalhoheit (etwa die Richterernennung) als
auch die Budgethoheit (Ausarbeitung eines Budgetentwurfs, direkte
Budgetverhandlungen mit dem Bundesministerium für Finanzen) obliegen. Um die
Arbeitsfähigkeit und Effektivität des Gremiums sicher zu stellen, solle ein ca
fünfköpfiger Exekutivausschuss gebildet werden. Durch die Einbindung der maßgeblichen
politischen Kräfte in den Vorgang der Richterernennung solle das Vertrauen der
Politik in die Justiz gestärkt werden.
Das
Modell des „Rats der Gerichtsbarkeit“ in der vorgeschlagenen Form stieß im
Ausschuss aus grundsätzlichen demokratiepolitischen Erwägungen und aus Gründen
der Gewaltenteilung eher auf Skepsis (sowohl hinsichtlich der Personalhoheit
als auch hinsichtlich der Budgethoheit). Es wurde vor der Gefahr der zukünftig
verstärkt zu erwartenden Verpolitisierung der Richterernennung durch die
Teilnahme von Mitgliedern aller im Nationalrat vertretenen Parteien gewarnt.
Was die budgetäre Seite betrifft, wurde einerseits darauf hingewiesen, dass die
Erstellung eines Budgetvorschlags ein sehr hohes Maß an Sachverstand
voraussetze und dass es für die Richterschaft andererseits besser sei, wenn der
Justizminister als Regierungsmitglied den „Kampf ums Budget“ mit dem
Finanzminister (als seinem Regierungskollegen) führt. Schließlich würde –
wollte man dem Richterrat tatsächlich die Budgethoheit übertragen – dies zu
einem Auseinanderfallen von Einnahmen- und Ausgabenverantwortung führen, was
schon aus grundsätzlichen ökonomischen Erwägungen nicht wünschenswert sei.
Zum
Teil gab es jedoch auch Verständnis für das Anliegen, die Interessen und die
Bedürfnisse der Gerichtsbarkeit unmittelbar gegenüber der politischen
Verantwortung zu vertreten. Insoweit Bedenken gegen ein solches justizielles
„Mischorgan“ und gegen die Einbindung von politischen Mandataren angemeldet
wurden, wurde dem entgegengehalten, dass eventuell auch ein Kollegialorgan,
allenfalls mit Beteiligung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und mit einer
hervorgehobenen Stellung des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs vorstellbar
wäre, das die besondere Stellung der Gerichtsbarkeit – als gegenüber der
Gesetzgebung und Verwaltung gleichberechtigte Staatsgewalt – etwa in Personal-
und Budgetfragen stärker als jetzt zum Ausdruck bringen könnte (Einrichtung
eines „Justizrats“). Um die in diesem Zusammenhang angestellten Überlegungen
noch zu vertiefen, wurde auch angeregt, das Büro des Österreich-Konvents möge
einen internationalen Vergleich über die Organisation der Spitzen der
Justizverwaltung einholen.
I) 2) Zur Bindungswirkung der Besetzungsvorschläge der richterlichen
Personalsenate
Was die Personalauswahl betrifft, sollte es nach der mehrheitlichen Meinung des Ausschusses beim bisherigen System der Erstattung von Besetzungsvorschlägen durch die Personalsenate bleiben, wobei auch die Frage erörtert wurde, ob diese Besetzungsvorschläge gegenüber dem letztlich entscheidenden Bundesminister für Justiz mit „relativer Bindungswirkung“ ausgestattet werden sollten (das heißt, der Justizminister zumindest verpflichtet sein sollte, einen der vorgeschlagenen Bewerber zu ernennen). Hier entwickelten sich im Ausschuss sozusagen zwei „Denkschulen“: Während die einen die Meinung vertraten, dass sich das bisherige Bestellungsverfahren im Justizbereich (keine „relative“ Bindungswirkung der Besetzungsvorschläge der Personalsenate gegenüber dem Justizminister) bewährt habe und dieses Verfahren auch in Zukunft (auch für die Verwaltungsgerichte; dazu später unter Punkt IV)) gelten solle, traten die anderen dafür ein, die Besetzungsvorschläge der Personalsenate (sowohl im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit als auch für die zukünftigen Verwaltungsgerichte) verbindlich zu machen, zumal die Personalsenate in der ordentlichen Gerichtsbarkeit derzeit aus immerhin fünf Berufsrichtern bestehende Kollegialorgane seien und aufgrund der alle vier Jahre durchzuführenden Personalsenatswahlen auch in hohem Maße berufsständisch legitimiert seien. Überdies hätten die Justizminister in den letzten Jahren, ja sogar Jahrzehnten, ohnedies niemals einen in diesen Besetzungsvorschlägen überhaupt nicht vorkommenden Bewerber ernannt.
Vorgeschlagen, aber noch nicht im Detail im Ausschuss besprochen wurde auch, den Personalsenaten ein Mitspracherecht bei der Auswahl und Aufnahme in den richterlichen Vorbereitungsdienst einzuräumen. Um eine größere Transparenz bei der Aufnahme in den richterlichen Vorbereitungsdienst zu erreichen und damit den gleichen Zugang zum Richterberuf abzusichern, wurde auch die Einschaltung eines anonymisierten Auswahlverfahrens (eines „Concours“), wie er in vielen Ländern existiere, vorgeschlagen.
Um das Gesamtprojekt bzw das Ziel einer rechtsstaatlichen Verbesserung durch Einführung von (Landes-)Verwaltungsgerichten nicht zu gefährden, zeichnete sich im Ausschuss eine Zustimmung zum Verzicht auf bindende Besetzungsvorschläge ab. Das in der ordentlichen Gerichtsbarkeit so gut wie nicht (und schon lange nicht mehr) in Anspruch genommene Abweichen vom Besetzungsvorschlag zu Gunsten einer/eines Nichtnominierten wurde in diesem Zusammenhang von einigen Ausschussmitgliedern als präventiv wirkende „Notbremse“ gesehen. Vorgeschlagen wurde auch, dass der Bundesminister für Justiz bei seiner Auswahl einer Begründungspflicht unterliegen sollte.
Im Zusammenhang mit der Einrichtung einer in Instanzen gegliederten Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts wurde mehrfach das Anliegen vertreten, dass die Bereiche der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts wechselseitig durchlässiger werden sollten. Dies setzt natürlich entsprechende Ausbildungsmaßnahmen voraus. Konsens bestand hierbei, dass eine solche wechselseitige Durchdringung die Qualität der Rechtssprechung erhöhen könnte, insbesondere auch in Grenzbereichen zwischen öffentlichem und privatem Recht.
II) Ordentliche Gerichtsbarkeit
Das Generalthema „Ordentliche Gerichtsbarkeit“ war Gegenstand der Ausschusssitzungen vom 16.12.2003, vom 28.1.2004 (und der dabei jeweils durchgeführten Hearings) und vom 12.2.2004.
II) 1) Gerichtsorganisation und
II) 2) Neuorganisation (OGH – OLG – Eingangsgerichte?)
Im
Ausschuss konnte Konsens in folgenden drei Punkten erzielt werden:
Sowohl
Art 92 B-VG, der den Obersten Gerichtshof (im Folgenden kurz: OGH) zur obersten
Instanz in Zivil- und Strafsachen erklärt, als auch Art 83 Abs 1 B-VG, wonach
die Verfassung und die Zuständigkeit der Gerichte durch Bundesgesetz (und nicht
etwa durch bloße Verordnung) zu regeln sind, als auch Art 88a B-VG, wonach die
Zahl der so genannten „Sprengelrichter“ mit 2% begrenzt ist, sollten
unverändert aufrecht belassen werden.
Ebenso
besteht im Ausschuss Konsens darüber, die Bestimmung des § 8 Abs 5 lit d) des
Übergangsgesetzes aus 1920 zu streichen (dazu näher unter Punkt II) 4)).
Inhaltlich
aufrecht bleiben und in den Verfassungstext integriert werden sollte dagegen §
28 ÜG 1920, wonach die (im Jahr 1920) geltenden Bestimmungen über die
Zuständigkeit und Zusammensetzung der Zivil- und Strafgerichte bis auf weiteres
in Kraft bleiben, womit offenbar der Zweck verfolgt wurde, bereits bestehende
Bestimmungen auf dem Gebiet von Zivil- und Strafgerichtsbarkeit, insbesondere
solche über die Laienbeteiligung, verfassungsrechtlich abzusichern.
Der
vom Bundesministerium für Justiz erstattete Vorschlag, die Gerichtsorganisation
(durch Zusammenlegung der derzeit bestehenden Bezirks- und Landesgerichte zu so
genannten „Eingangsgerichten“) von derzeit vier auf zukünftig drei Ebenen zu
reduzieren[2],
stieß im Ausschuss grundsätzlich auf Zustimmung; hinsichtlich der näheren
Details war man sich darüber einig, die Zahl und Zuständigkeit der
Eingangsgerichte nicht in der Verfassung zu regeln. Hinsichtlich der Zahl und
Organisation der Rechtsmittelgerichte (9 Landesgerichte oder 4
Oberlandesgerichte – allenfalls mit „Außensenaten“) konnte kein Konsens erzielt
werden. Von manchen Ausschussmitgliedern wurde darauf hingewiesen, dass an den
Standorten der jetzigen vier Oberlandesgerichte weiterhin die Justizverwaltung
wahrgenommen werden könnte, es jedoch auch in Zukunft in jedem Bundesland
zumindest ein Rechtsmittelgericht geben müsse. Eine Auffassung
ging dahin, dass durchgängig in jedem Bundesland ein Landesgericht als
Rechtsmittelgericht eingerichtet werden sollte und die Landesgerichte an den
Standorten der bisherigen Oberlandesgerichte zusätzlich die Justizverwaltung
für den gesamten bisherigen Sprengel weiterhin wahrnehmen sollten. Ein möglicher Kompromiss in
dieser Frage könnte – im Sinne der Ausführungen von Peter G. Mayr[3]
– darin liegen, die vier Oberlandesgerichte als Justizverwaltungszentren zu
belassen, jedoch Rechtsmittelinstanzen in sämtlichen Landeshauptstädten – etwa
durch Schaffung entsprechender Außenstellen der vier Oberlandesgerichte – zu etablieren.
Auch
wenn nicht verkannt wird, dass die immer komplexer werdende Rechtsordnung ein
gewichtiges Argument für eine Spezialisierung auch innerhalb der Richterschaft
darstellt, erscheint dem Ausschuss mehrheitlich die verfassungsrechtliche
Verankerung einer dreistufigen Gerichtsorganisation auch deshalb entbehrlich,
weil man in der Vergangenheit diesbezüglich mit relativ wenigen Bestimmungen
auf Verfassungsebene (Art 83 und 92 B-VG, §§ 8 Abs 5 lit d) und 28 ÜG 1920) gut
ausgekommen ist und der Bedarf für mehr Bestimmungen über die
Gerichtsorganisation in der Verfassung nicht erkennbar ist. Fragen der
Gerichtsorganisation sollten – wie bisher – Gegenstand der Justizpolitik sein
und einfachgesetzlich geregelt werden. Die derzeitige Verfassungsrechtslage ist
– so die überwiegende Meinung im Ausschuss – einerseits bestimmt genug, um den
einfachen Gesetzgeber hinreichend zu determinieren, und andererseits flexibel
genug, um auf Änderungen im Faktischen entsprechend rasch reagieren zu können;
daran sollte grundsätzlich festgehalten werden.
II) 3)
Fragen zur Staatsanwaltschaft
II) 3)
a) Zur verfassungsrechtlichen Verankerung einer Bestands- und Funktionsgarantie
zugunsten der Staatsanwaltschaften
Wie
der Präsident der Vereinigung Österreichischer Staatsanwälte anlässlich des
Hearings am 16.12.2003 ausführte, hat sich die Rolle der Staatsanwaltschaften
in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert und kontinuierlich
verstärkt: So sind in den 80er Jahren die Diversionsregelungen im
Drogenstrafrecht und im Jugendstrafrecht sowie die diversionsnahe Regelung des
§ 42 StGB (Einstellung des Verfahrens wegen mangelnder Strafwürdigkeit der Tat)
den Staatsanwaltschaften zugewachsen. Durch die StPO-Novelle 1999 ist die
Diversionsregelung im allgemeinen Strafrecht (auch für Erwachsene) eingeführt
worden. Durch die vor kurzem beschlossene, umfassende StPO-Reform (Reform des
Vorverfahrens) wird diese Entwicklung einer Verstärkung und Erweiterung der
Rolle der Staatsanwaltschaft insofern weitergeführt, als an die Stelle der
Voruntersuchung ein abgegrenzter Bereich obligatorischer richterlicher
Beweisaufnahme getreten ist, die Staatsanwaltschaft zur verfahrensführenden
Behörde aufgewertet und ihr die Leitung und Durchführung des
Ermittlungsverfahrens – in Kooperation mit der Polizei – übertragen wurde.
Dieser Rollenwandel – so der Präsident der Vereinigung Österreichischer
Staatsanwälte – sei mit der Umsetzung der StPO-Reform noch längst nicht
abgeschlossen. Die skizzierten Entwicklungen könnten auch durch die folgenden
Zahlen (aus dem Jahr 2000) belegt werden: in diesem Jahr sind insgesamt ca. 50%
der Anzeigen von den Staatsanwaltschaften zurückgelegt und weitere 18% der
Anzeigen diversionell behandelt worden, während nur mehr 22% der Fälle
angeklagt worden sind. Das bedeutet, dass nur mehr jeder fünfte angezeigte
Straffall letztlich vom Strafgericht entschieden wird.[4]
Vor
dem Hintergrund der genannten Zahlen und des dargelegten Wandels der Rolle
(aber auch des Rollenverständnisses) der Staatsanwaltschaften, die belegen,
dass die Staatsanwaltschaften sowohl funktionell (als Aufbereiter des
Prozessstoffes für die Entscheidung durch die Strafgerichte) als auch personell
(Richter und Staatsanwälte genießen dieselbe Ausbildung) als Teil der dritten
Staatsgewalt, nämlich der Gerichtsbarkeit, anzusehen sind, konnte – ungeachtet
der unterschiedlichen Einschätzung dieses Rollenwandels – im Ausschuss Konsens
darüber erzielt werden, zugunsten der Staatsanwaltschaften sowohl eine Bestands-
als auch eine Funktionsgarantie (als öffentliche Ankläger) verfassungsrechtlich
zu verankern. Auf der Grundlage eines von der Vereinigung Österreichischer
Staatsanwälte erstatteten Vorschlags für einen (nach dem jetzigen System) neuen
Art 90 Abs 3 B-VG[5] wurde in
Zusammenarbeit mit dem Leiter der Straflegislativsektion im Bundesministerium
für Justiz, Sektionschef Dr. Miklau, ein Textvorschlag erarbeitet, der
im Besonderen Teil (mitsamt Erläuterungen) abgedruckt ist.[6]
Der
Vorschlag von Dr. Miklau fand im Ausschuss breite Zustimmung. Als
problematisch wurde lediglich der Verweis auf die Strafprozessordnung
angesehen; es wurde darauf hingewiesen, dass dieser Verweis deshalb notwendig
sein könnte, um den vorliegenden Entwurf einer Strafprozessreform
verfassungsrechtlich abzusichern. Als Konsens wurde schließlich festgehalten,
dass den Staatsanwaltschaften die „justizielle Strafverfolgung“ per
Verfassungsbestimmung zugewiesen werden solle. Ein Verweis auf die StPO sollte
unterbleiben und in die Erläuterungen zum Gesetzesentwurf vielmehr ein Hinweis
aufgenommen werden, dass vom bisherigen Stand der Strafprozessordnung und ihrer
Weiterentwicklung auf einfachgesetzlicher Ebene ausgegangen wird.
II) 3) b) Zu Fragen des Weisungsrechts
Der
Präsident der Vereinigung Österreichischer Staatsanwälte meinte anlässlich des
Hearings am 16.12.2003, dass das Weisungsrecht zwar grundsätzlich sehr wohl
seine Berechtigung habe, die Weisungshierarchie jedoch justizintern bleiben und
nicht – wie derzeit – beim Bundesminister für Justiz und damit außerhalb der
Justiz enden solle. Die für die Tätigkeit der Staatsanwälte notwendige
Kontrolle und Weisungshierarchie solle keine politische, sondern vielmehr eine
streng juristische sein, weshalb das Weisungsrecht – auch aus Gründen der
„Optik“ – vom Bundesminister für Justiz auf die Generalprokuratur übertragen
werden solle. Ob die
Generalprokuratur dafür das geeignete Organ sei, stieß jedoch im Ausschuss auf
Skepsis.
Es
wurde die Beibehaltung des derzeitigen Systems des Weisungsrechts und auch der
derzeitigen Weisungshierarchie verlangt. Einerseits wurde vor einer
Verpolitisierung der Generalprokuratur (bzw jeder anderen Form einer zukünftigen
Weisungsspitze) gewarnt und andererseits darauf hingewiesen, dass die
Generalprokuratur aufgrund des ihr eingeräumten Rechts zur Erhebung einer
Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes derzeit nur „Rechtswahrerin“
sei, während sie in Zukunft zu einer viel politischeren Institution werden
würde.
Im Laufe der
Ausschussarbeit wurden zum Weisungsrecht des Bundesministers für Justiz
gegenüber der Staatsanwaltschaft folgende Modelle diskutiert:
a)
Beibehaltung des gegebenen Zustands bei verbesserter Transparenz, etwa durch
Einrichtung eines parlamentarischen Ausschusses;
b)
Inhaltliche Änderungen des Weisungsrechts, durch
ba)
Ausschluss von Negativ-Weisungen und/oder
bb)
Beschränkung auf fachliche Weisungen;
c)
Generalprokurator als Spitze einer Weisungshierarchie ohne Durchgriff des
Bundesministers für Justiz;
d)
Einrichtung eines Bundesstaatsanwalts; dieser Bundesstaatsanwalt soll die
oberste staatsanwaltschaftliche Behörde sein, gegenüber den anderen
staatsanwaltschaftlichen Behörden weisungsbefugt, jedoch selbst weisungsfrei
sein; er soll vom Nationalrat in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der
Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen – auf
Grund eines Vorschlags des Hauptausschusses und nach vorheriger öffentlicher
Ausschreibung und Anhörung (unter Beteiligung von Vertretern der Richter und
Staatsanwälte) – für die Dauer von sechs Jahren gewählt werden (einmalige
Wiederwahl möglich); er unterliegt dem parlamentarischen Interpellationsrecht;
im Einzelnen wird hiezu auf Initiativanträge der sozialdemokratischen
Parlamentsfraktion verwiesen (329/A XXI. GP, 126/A XXII. GP);
e) Sonstige Vorschläge: Verschiedentlich wurde die Auffassung vertreten, dass die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit ex post von einem parlamentarischen Kontrollausschuss überprüft werden sollte.
Als weitere „Unter-Varianten“
wurden diskutiert, dass ausgenommene Weisungsbereiche einer nachprüfenden
Kontrolle unterzogen werden sollen oder dass das Weisungsrecht des
Justizministers nur dann bestehen solle, wenn der Staatsanwalt und der
Oberstaatsanwalt unterschiedliche Meinungen vertreten. Jede dieser Varianten
stieß aber letztlich auf mehr oder weniger große Skepsis.
Hinsichtlich
der inhaltlichen Ausgestaltung des Weisungsrechts stieß die Forderung nach
Abschaffung des so genannten „negativen Weisungsrechts“[7]
im Ausschuss nur teilweise auf Zustimmung: Hier wurde von den einen – als
Argument für die Abschaffung des negativen Weisungsrechts – die Frage
aufgeworfen, was denn die unabhängigste Justiz nütze, wenn man sie – über den
„Umweg“ der ministeriell veranlassten Verfahrenseinstellung – gar nicht erst
tätig werden lasse. Von anderen wurde hingegen – als Argument für die
Beibehaltung des negativen Weisungsrechts – die Gefahr vor den „wild
gewordenen“ Staatsanwälten und der drohenden medialen Vorverurteilung von (zu
Unrecht) angeklagten Personen beschworen.
Interesse
fand die von Miklau[8]
vorgeschlagene Formel, wonach das negative Weisungsrecht zwar nicht völlig
abgeschafft, wohl aber dadurch spürbar eingeschränkt werden solle, dass der
weisungsgebundene Staatsanwalt in Zukunft lediglich an (in die Form von
Weisungen gegossene) rechtliche Beurteilungen der Weisungsspitze gebunden sein
solle, dass es aber kein negatives Weisungsrecht unter Berufung auf die zu
schwache Beweislage, also keine „die Suppe ist zu dünn“-Weisung, mehr geben
dürfe. Freilich wirft dieser Vorschlag die Frage auf, inwieweit sich die Grenze
zwischen der rechtlichen Beurteilung und der Beurteilung der Beweislage in der
praktischen täglichen Arbeit des Staatsanwalts sauber ziehen lässt.
Eine
weitere Idee, mit der man auch die Generalprokuratur wieder ins Spiel brächte,
könnte darin bestehen, das schon bestehende Instrument der Subsidiaranklage
gemäß § 48 StPO nutzbar zu machen.[9]
Nach dieser Bestimmung kann ein Privatbeteiligter – grob gesprochen das Opfer
einer Straftat – in bestimmten Fällen (wenn die Strafanzeige zurückgelegt wird
oder der Staatsanwalt von der Verfolgung oder von der Anklage zurücktritt) die
öffentliche Anklage übernehmen und so gleichsam an die Stelle des Staatsanwalts
treten. Da es sich aber bei den vom ministeriellen (negativen) Weisungsrecht
erfassten Fällen in der Regel um eher „clamorose“ Fälle bzw solche mit einer
gewissen „politischen Schlagseite“ handelt, die sich sehr oft gegen die
öffentliche Hand (etwa im Fall des Amtsmissbrauchs gemäß § 302 StGB) oder gegen
die Rechtspflege (zB im Fall der falschen Zeugenaussage gemäß §§ 288 f StGB),
nicht jedoch gegen konkret festzumachende Personen als unmittelbare Opfer
richten, geht das Recht zur Erhebung der Subsidiaranklage in solchen Fällen
zumeist ins Leere. In eben diesen Fällen könnte man der Generalprokuratur in Zukunft
das – innerhalb einer bestimmten Frist (von zB einem Monat) auszuübende – Recht
zur Erhebung einer Subsidiaranklage einräumen. Diese Konstruktion würde der
Generalprokuratur zwar zugegeben einen etwas „politischeren“ Charakter
verleihen und stünde nach derzeitiger (insoweit zu ändernder) Rechtslage wohl
auch in einem gewissen Spannungsverhältnis zu § 2 Abs 1
Staatsanwaltschaftsgesetz, wonach auch die Generalprokuratur dem Weisungsrecht
des Justizministers unterliegt; davon abgesehen würde sie sich aber in das
bestehende System der Generalprokuratur als „Rechtswahrerin“ einfügen lassen
und aufgrund ihrer prohibitiven Wirkung die schon jetzt niedrige Zahl
ministerieller Weisungen wohl weiter senken.
Die
beiden zuletzt genannten Ideen wurden im Ausschuss jedoch nicht mehr eingehend
diskutiert. Es fiel auch das Argument, es sei auch das interne Weisungsrecht im
Bereich der Staatsanwaltschaft abzuschaffen und es seien die Staatsanwälte wie
Richter voll unabhängig zu stellen, wenn man schon mit der umfassenden
Aufgabenänderung der Staatsanwälte argumentiere.
Einigkeit
bestand im Ausschuss jedenfalls darüber, dass aufgrund des – unter Punkt II) 3)
a) dargelegten und
mit Zahlen untermauerten – Wandels der Rolle und des Rollenverständnisses der
Staatsanwaltschaften sowie insbesondere der vor kurzem beschlossenen
großen Strafprozessreform eine Verschärfung der Problematik des Weisungsrechts
des Justizministers eingetreten ist und dass die Ausübung des Weisungsrechts
durch den Justizminister – etwa durch Einrichtung eines eigenen
parlamentarischen Kontrollausschusses (der die Ausübung des Weisungsrechts ex
post kontrollieren sollte) – noch transparenter gestaltet werden sollte. Es gab
auch den Vorschlag, die staatsanwaltsinternen Weisungen im Gerichtsakt einsehbar
zu machen.
Schließlich
ist – einem entsprechenden Wunsch folgend – darauf hinzuweisen, dass die
dargebotene Wiedergabe der Weisungsrechtsdiskussion auf den Ergebnissen der
Gespräche vor Verabschiedung der StPO-Reform fußt.
Exkurs:
Fragen zur Beibehaltung der Laiengerichtsbarkeit
Die Frage, ob die ausdrückliche verfassungsrechtliche Verankerung der Schöffen- und Geschworenengerichtsbarkeit in Art 91 B-VG bzw – noch grundsätzlicher – ob die Laiengerichtsbarkeit in ihrer derzeitigen Form überhaupt beibehalten werden solle, konnte im Ausschuss – angesichts der Fülle und Komplexität der zu diskutierenden Probleme und der Knappheit der zur Verfügung stehenden Zeit – bisher noch nicht eingehend diskutiert werden.
II) 4) Entfall
der Mitkompetenz der Landesregierungen bei Sprengeländerungen der Gerichte?
Wie bereits kurz erwähnt, besteht im Ausschuss grundsätzlich Konsens darüber, die Bestimmung des § 8 Abs 5 lit d) des Übergangsgesetzes aus 1920[10] (im Folgenden kurz: ÜG 1920), wonach Verordnungen über Änderungen in den Sprengeln der Bezirksgerichte nur mit Zustimmung der jeweiligen Landesregierung erlassen werden dürfen, ersatzlos zu streichen. Als Argument für diesen Entfall wurde im Ausschuss ins Treffen geführt, dass diese Bestimmung im Bereich der ansonsten bundesgesetzlich geregelten Gerichtsbarkeit einem „Fremdkörper“ gleiche und wohl auch nur historisch erklärbar sei. Diese Regelung sollte ja nach dem Einleitungssatz des § 8 Abs 5 ÜG 1920 auch nur bis zu jenem Zeitpunkt gelten, in dem die Organisation der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Ländern durch ein gemäß Art 120 B-VG zu erlassendes Bundesverfassungsgesetz und die Ausführungsgesetze hiezu geregelt ist; tatsächlich ist ein solches Bundesverfassungsgesetz bis heute nicht erlassen worden.[11]
Allenfalls
könnte der Entfall
dieser Bestimmung durch eine – verstärkte – Mitwirkung der Länder an der
Bundesgesetzgebung (etwa im Wege des Bundesrats) ausgeglichen werden. Zum Teil
wurde dezidiert gefordert, es möge der Aspekt der verstärkten Mitwirkung der
Länder bei den Überlegungen des Ausschusses 3 zur Neugestaltung des Bundesrats
berücksichtigt werden.
III) Gerichtshöfe öffentlichen Rechts und
Höchstgerichte überhaupt
Das Generalthema „Gerichtshöfe öffentlichen Rechts“ war vornehmlich
Gegenstand der Ausschusssitzungen vom 12.2.2004 und 27.2.2004. Das Thema wurde
unter zwei – einander teilweise überlappenden – Gesichtspunkten diskutiert: Zum
einen stellte sich – nach Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit erster
Instanz (dazu näher unter Punkt IV) des Berichts) – im Ausschuss die Frage nach
dem Verhältnis zwischen dem VwGH und dem VfGH, zum andern wurde im Hinblick auf
einen allfälligen Ausbau des Grundrechtsschutzes und der Normenkontrolle die
Frage nach dem Verhältnis des VfGH zu den beiden anderen Höchstgerichten und
zur ordentlichen Gerichtsbarkeit insgesamt aufgeworfen. Im Einzelnen wurde vom
Ausschuss dazu Folgendes erwogen:
III) 1) Verhältnis der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts sowie aller drei Höchstgerichte zueinander
III) 1) a) Zur Konzentration der Verwaltungsgerichtsbarkeit beim
VwGH
Die Entwicklung
des Verfassungsrechts in Österreich – hier die Prüfungskompetenz des
Reichsgerichts, dort jene des VwGH – hat zu einer Doppelgleisigkeit der
Verwaltungsgerichtsbarkeit geführt. Diesbezüglich bestand im Ausschuss relativ
weitgehende Übereinstimmung darin, dass die
Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit des VfGH im Falle einer instanzenmäßig
gegliederten Verwaltungsgerichtsbarkeit in gewisser Weise systemfremd – der
VfGH wäre zwischen einem Verwaltungsgericht ersten Instanz und dem
nachgeschalteten Verwaltungsgerichtshof anzurufen – und kompliziert wäre.
Gegenüber einer Abschaffung der Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit im
Zusammenhang mit der Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz
(in einer der im Folgenden dargestellten Varianten) wurde im Ausschuss
teilweise die Auffassung vertreten, dass eine solche Konstruktion als Fernziel
einer Reform nicht aus dem Auge verloren werden sollte, zum gegenwärtigen
Zeitpunkt aber abzuwarten sei, inwieweit die Einführung der Verwaltungsgerichte
erster Instanz zu einer tatsächlichen Entlastung des VwGH führen werde. Dem
wurde von anderen Mitgliedern entgegengehalten, dass angesichts der geringen
Anzahl von Aufhebungen durch den VfGH in Verfahren nach Art 144 B-VG – die
amtswegigen Normenkontrollverfahren einmal außer Acht gelassen – eine massive
Mehrbelastung des VwGH, die die Entlastung durch die Verwaltungsgerichte erster
Instanz aufheben würde, nicht zu erwarten sei.
III) 1) b) Zur
„Umdrehung“ der Sukzessivbeschwerde
Es wäre möglich,
das bisherige System des Art 144 Abs 1 B-VG auf die Weise zu vereinfachen, dass
die Reihenfolge der prüfenden Gerichtshöfe umgedreht wird: Die Beschwerde wäre
also zunächst an den VwGH und danach an den VfGH zu richten. Tatsächlich führt
das gegenwärtige System nicht nur zu einer erheblichen Zahl von
„sicherheitshalber“ an den VfGH herangetragenen Sukzessivbeschwerden, sondern
ist in seiner spezifischen Logik – quasi „Zwischenschaltung des VfGH“ zwischen
Verwaltungsbehörde und VwGH – nicht leicht vermittelbar.
Gegen
diesen Vorschlag wurde von einzelnen Mitgliedern eingewendet, dass diesfalls
der VfGH zur verwaltungsgerichtlichen „Überinstanz“ über dem VwGH werden
könnte. Zwar bestehe zwischen VfGH und VwGH ein unterschiedlicher
Prüfungsmaßstab: Während der VfGH die Verletzung in verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Rechten zu prüfen hat, die vielfach nur bei gehäuftem Verkennen
der Rechtslage oder Verstoß gegen materielle Eingriffsvorbehalte vorliegt (so
genannte „Grobprüfung“), hat der VwGH jede Verletzung in subjektiven Rechten zu
prüfen. Tatsächlich könnte aber dann, wenn der VwGH bei der Prüfung der
behaupteten Verletzung in subjektiven Rechten zur Abweisung einer Beschwerde
kommt, der VfGH aber die Entscheidung des Verwaltungsgerichts erster Instanz
wegen Verletzung in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten aufhebt, dies
zum Effekt führen, dass entweder das zugrunde liegende einfache Gesetz
verfassungswidrig sein müsste oder der Verwaltungsgerichtshof die
einfachgesetzliche Rechtslage verkannt hat.
III) 1) c) Zum Subsidiarantrag und zur Urteilsbeschwerde
Dieses Thema war vor allem Gegenstand der Ausschusssitzung vom 12.2.2004. Bei der damaligen Diskussion wurden insbesondere die nachfolgenden „Leitgedanken“ thematisiert:
- Konzentration der
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Rechtsakten bei einem Gericht, nämlich
beim VfGH;
- Erweiterung der
Möglichkeit, behauptete Rechtswidrigkeit genereller Normen an den VfGH
heranzutragen;
- Vermeidung von zu
komplizierten, für den Rechtsunterworfenen nur schwer durchschaubaren
Verfahrenskonstellationen;
- Wahrung der
Gleichrangigkeit der drei Höchstgerichte als Ausdruck der Gewaltenteilung und
einer – entsprechend der jeweils überwiegenden Bedeutung der inhaltlich
tatsächlich zu entscheidenden Fragen vorgenommenen – aufgabenspezifischen
Organisation, die zwar allenfalls Verfahren zu trennbaren
Verfahrensgegenständen (Gesetzesprüfungsverfahren, Vorabentscheidungsverfahren)
zwischenschaltet, sonst aber die Verantwortungsbereiche nach
„Rechtsstreitigkeiten“ klar aufteilt (gegen ein organisatorisch verstandenes
Gleichrangigkeitsprinzip gab es zum Teil ausdrücklich Widerspruch).
ca) Zum Subsidiarantrag
Ein Manko in der
Normenkontrolle wird darin gesehen, dass die zur Anfechtung nach Art 140 Abs 1
B-VG ermächtigten Gerichte – allenfalls auch trotz entsprechender Anregungen
seitens der Verfahrensparteien – keine Normprüfungsanträge an den VfGH stellen,
weshalb verfassungsrechtlich bedenkliche generelle Normen lange in Geltung
bleiben können. In erster Linie betrifft diese Frage die Justiz. Für den VwGH
stellt sich – im Hinblick auf Art 144 Abs 1 zweiter Fall B-VG – dieses Problem
nicht in der selben Schärfe, aber grundsätzlich doch auch. In die
Ausschussdiskussion wurde daher die Konstruktion eines „Subsidiarantrags“
eingebracht. Dieser solle es dem Beschwerdeführer ermöglichen, nach Abschluss
des Verfahrens vor einem antragsberechtigten Gericht oder dem VwGH einen Antrag
auf Normprüfung an den VfGH zu stellen. Der Subsidiarantrag hätte den Vorteil,
dass damit der VfGH in Zukunft vermehrt die Möglichkeit hätte, als verfassungswidrig
angefochtene Gesetzesbestimmungen zu prüfen.
Wenn der VfGH die Norm
dann aufhebt, wäre das Verfahren vor den Gerichten fortzusetzen. Im Ausschuss
bestand die einhellige Meinung, dass ein solches Instrument einen Teil des
vorhandenen Problempotenzials abschöpfen könnte. Übrig blieben seltene Fälle
einer „verfassungskonformen Auslegung“. Für den Fall der Aufhebung der (vom
VfGH als verfassungswidrig erkannten) Gesetzesbestimmung müssten die Verfahren
- als eine Art „Ergreiferprämie“ – von den Gerichten auf der Grundlage der
bereinigten Rechtslage fortgeführt werden (ein Wiederaufnahmeverfahren wurde
zwar überlegt, jedoch wegen des Zeitfaktors letztlich nicht für zweckmäßig
erachtet): Das Verfahren wäre diesfalls also vor den Verwaltungsgerichten und
Verwaltungsbehörden oder vor den ordentlichen Gerichten wieder aufzunehmen.
Dieser Subsidiarantrag wurde im Ausschuss nur insoweit konsentiert, als er
gegenüber der geltenden Verfassungsrechtslage als Verbesserung gesehen wurde.
Ein Teil der Mitglieder hat sich für die weitergehende „Urteilsbeschwerde“
ausgesprochen.
Für die legistische
Gestaltung des Subsidiarantrags liegt ein Erstentwurf von Präsident Univ.-Prof.
Dr. Jabloner und Univ.-Prof. DDr. Grabenwarter vor. Hier ist zweifellos noch
legistische Feinarbeit zu leisten. So wurde etwa darauf hingewiesen, dass noch
zu entscheiden sein wäre, ob ein Subsidiarantrag schon während des
gerichtlichen Verfahrens und wie lange er nach einer Entscheidung gestellt
werden könnte.
cb) Zur Urteilsbeschwerde („Verfassungsbeschwerde“)
Wenn man ein System
anstreben wollte, bei dem sämtliche Verfassungsfragen letztlich vom VfGH
beantwortet werden, müsste man den eingeschlagenen Weg des – oben dargestellten
und im Ausschuss konsentierten – Subsidiarantrags weiter in Richtung einer
einheitlichen „Urteilsbeschwerde“ gehen. Bei dieser Variante hätte der Einzelne
die Möglichkeit, unmittelbar das höchstgerichtliche Urteil wegen
„Verfassungswidrigkeit“ beim VfGH anzufechten. Für eine solche Konstruktion
sprechen die Klarheit der Lösung und die Sicherung der Einheitlichkeit der
Verfassungsrechtssprechung.
Gegen eine solche
Konstruktion sprechen die Einführung quasi einer vierten Instanz und damit
verbundene Verfahrensverzögerungen sowie – nach Meinung vieler – die explizite
Aufgabe der Gleichrangigkeit der Höchstgerichte.
Dazu kommt die schon mit der Einführung des Subsidiarantrags (im eingeschränkten Umfang) verbundene Gefahr, dass davon exzessiv Gebrauch gemacht werden könnte. Zu überlegen ist auch der Umstand, dass das Fehlen einer gesicherten VfGH-Judikatur in neuen Rechtsgebieten und die dem entsprechend schwierige Prognostizierbarkeit künftiger Entscheidungen die Erhebung solcher Urteilsbeschwerden sehr verlockend machen würde. Hingewiesen wurde auch darauf, dass der geforderte Ausbau des Rechtsschutzes zugunsten der beschwerdeführenden Partei stets auf Kosten der anderen Verfahrenspartei ginge, die regelmäßig einen kosten- und zeitintensiven Prozess durch drei Instanzen gewonnen hätte und dann erst recht wieder vor der Situation stünde, eine Verlängerung des Prozesses (und damit der Zeit der Ungewissheit) und eine weitere Verzögerung des Eintritts der Rechtskraft und der Vollstreckbarkeit des (für sie günstigen) Urteils in Kauf nehmen zu müssen.
Schließlich wurde von einzelnen Mitgliedern auch die Auffassung vertreten, die Systeme der „Verfassungsbeschwerde“ und des Subsidiarantrags ließen sich im Interesse des Prinzips der Gleichrangigkeit der Höchstgerichte auch kombinieren. Im Einzelnen wurde folgendes Modell vorgeschlagen:
Sowohl
der OGH als auch der VwGH erhalten die Aufgabe, förmlich über die behauptete
Verletzung in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten (Grundrechten)
abzusprechen. Nur gegen diesen Teil des Ausspruches kann – ebenso wie einer
nicht Folge gegebenen Anregung auf Normenkontrolle – der VfGH angerufen werden.
Stellt der VfGH abweichend von der Entscheidung des OGH oder des VwGH fest,
dass der Beschwerdeführer in Grundrechten verletzt wurde, ist das jeweilige
Höchstgericht verpflichtet, in seinem Bereich der Rechtsanschauung des VfGH
Rechnung zu tragen, etwa durch Aufhebung eines bei ihm bekämpften Urteils oder
einer inhaltlichen Stattgebung der Beschwerde uä. Dieses System wirkt zwar auf
den ersten Blick kompliziert, entspricht aber auch sonst dem Verhältnis
zwischen gleichrangigen Höchstgerichten, etwa zwischen dem EuGH oder dem EGMR
und den nationalen Höchstgerichten. Ein Vorteil dieser Konstruktion läge darin,
dass auf die unterschiedlichen Auswirkungen von Grundrechtsverletzungen in den
einzelnen Rechtsmaterien, insbesondere auch im Zivilrecht, vom zuständigen
Gericht Bedacht genommen werden könnte.
cc) Zur Erweiterung der Vorlagepflicht gemäß Art 89
B-VG und der Grundrechtsbeschwerde nach dem Grundrechtsbeschwerdegesetz
Schließlich wurden in diesem Zusammenhang kurz die schon jetzt bestehenden Rechtsinstitute des Rechts der ordentlichen Gerichte auf Stellung eines Gesetzesprüfungsantrags (Art 89 Abs 2 B-VG) und der Grundrechtsbeschwerde an den OGH (nach dem Grundrechtsbeschwerdegesetz [GRBG]) angesprochen, mit denen man das Problem der mangelnden Befassung des VfGH ebenfalls – flankierend – in den Griff bekommen könnte: So könnte man einerseits Art 89 Abs 2 B-VG dahingehend abändern, die bisher nur dem OGH und den Gerichten zweiter Instanz überbundene Verpflichtung, bei Vorliegen verfassungsrechtlicher Bedenken einen Antrag auf Aufhebung des Gesetzes beim VfGH zu stellen, auf alle Gerichte (also auch jene erster Instanz) auszudehnen. Andererseits könnte man im Sinne von Matscher und Ratz[12] den Anwendungsbereich der Grundrechtsbeschwerde nach dem GRBG auf andere Grundrechte, wie etwa das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, ausdehnen.
Zusammenfassend konnte
im Ausschuss somit Konsens erstens über die Einführung einer
Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz (dazu näher im Folgenden unter Punkt
IV)) und zweitens über die Einrichtung eines Subsidiarantrags erzielt werden,
wobei aber kein Konsens darüber bestand, dass allein diese beiden Maßnahmen
umgesetzt werden sollten. Für diese legistischen Maßnahmen werden konkrete –
von Präsident Univ.-Prof. Dr. Jabloner und Univ.-Prof. DDr. Grabenwarter
ausgearbeitete, jedoch im Ausschuss noch nicht im Einzelnen besprochene –
Normtexte vorgelegt.[13]
Weitere Reformmaßnahmen, die einzelnen Mitgliedern des Ausschusses erforderlich
erscheinen, haben entweder bislang keinen Konsens gefunden
(„Urteilsbeschwerde“) oder wurden noch nicht behandelt (etwa Anlassfallwirkung,
vorläufiger Rechtsschutz, Verbandsklagen, Umsetzung von Urteilen des EGMR). Sie
könnten allenfalls in einer späteren Phase der Konvents- und
Verfassungsentwicklung wieder diskutiert werden.
III) 2) Problembereiche (zB
Verwaltungsgerichtshof ®
Belastung)
Laut Tätigkeitsbericht des VwGH für das Jahr 2002 waren am Beginn des Berichtsjahres 8.931 Rechtssachen des Beschwerderegisters und 355 Rechtssachen des Registers für Anträge, die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, anhängig. Gegenüber dem Beginn des Jahres 2001 bedeutete dies eine Erhöhung bei den Beschwerdesachen um 136 und bei den Anträgen auf aufschiebende Wirkung um 51 Fälle. Am Ende des Berichtsjahres (2002) verblieben 8.880 anhängige Rechtssachen des Beschwerderegisters und 306 anhängige Anträge auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verringerung bei den Beschwerdesachen um 51 (oder 0,57%) und bei den Anträgen auf aufschiebende Wirkung um 49 (oder 13,80%).
Im Vergleich dazu bestanden am Beginn der Berichtsjahre 1994 bis 2001 folgende Rückstände:
1994: 5.963 1998: 16.291
1995: 6.442 1999: 13.118
1996: 9.751 2000: 9.332
1997: 13.638 2001: 8.795
Daraus ist zu ersehen, dass die Anfallszahlen im Laufe der 90er Jahre kontinuierlich gestiegen sind, in den Jahren 1997/1998 ihren Höhepunkt erreicht haben, danach wieder leicht gesunken sind und sich nunmehr – auf hohem Niveau – eingependelt haben.
Die durchschnittliche Erledigungsdauer der 4.595 mit Sachentscheidung (Erkenntnis) erledigten Bescheidbeschwerden betrug (vom Tag des Einlangens bis zum Tag der Beschlussfassung im Senat) etwas über 21 Monate (bis 1995 konstant rund 11, 1996 13, 1997 knapp 14, 1998 fast 17, 1999 fast 18, 2000 fast 20 und 2001 über 19 Monate) und bei den 19 mit Sachentscheidung erledigten Säumnisbeschwerden mehr als 37 Monate (etwa 38 Monate im Vorjahr); die Tendenz ist also aufgrund der starken Überlastung des VwGH jedenfalls steigend. Um diese chronische Überlastung des VwGH abzufangen, sollte nach einhelliger Ansicht des Ausschusses eine echte und umfassende Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz eingeführt werden (dazu näher unter Punkt IV) des Berichts).
III) 3) Mitwirkungsrechte der
Länder bei Bestellung der Spitzen und der
Zusammensetzung
III) 4) Bestellungsvorgang –
Transparenz – Hearing
Über diese beiden im Mandat genannten Punkte wurde im Ausschuss bisher noch nicht eingehend diskutiert.
III) 5) Kostentragung
Im Ausschuss wurde einhellig die Meinung vertreten, dass Fragen der Kostentragung im Ausschuss 9 ausgeklammert bleiben und vom Ausschuss 10 diskutiert werden sollten.
IV) Verwaltungsgerichtsbarkeit in den
Ländern
Das Generalthema „Einführung der (Landes)Verwaltungsgerichtsbarkeit“ war Gegenstand von vier Sitzungen der so genannten „kleinen Arbeitsgruppe“ am 21.11. und 15.12.2003 sowie am 22.1. und 26.1.2004 sowie insbesondere der Ausschusssitzung vom 13.2.2004.
IV) 1) Problemstellung – Kompetenzen, Instanzenzug
In der Arbeitsgruppe konnte grundsätzlich eine Einigung über die Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz in Bund und Ländern sowie darüber hinaus weitgehend Konsens über nachfolgend genannte „Eckpunkte“ erzielt werden (hier folgt der Ausschussbericht dem von Univ.-Prof. DDr. Grabenwarter in der Sitzung der „kleinen Arbeitsgruppe“ vom 21.11.2003 genannten Problemaufriss [siehe Protokoll, Seite 2 f]):
IV) 1) a) Zweigliedrigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit?
Es sollte einen zwei-, uU dreigliedrigen Instanzenzug geben, nämlich von der Verwaltungsbehörde zum Landesverwaltungsgericht (bzw zum Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz) und in bestimmten Fällen weiter zum VwGH. Es sollte in Zukunft nur mehr eine Verwaltungsinstanz geben (das Institut der Berunfungsvorentscheidung sollte vollumfänglich beibehalten werden); das Verwaltungsgericht 1. Instanz sollte grundsätzlich Rechtsmittelinstanz sein. Eine Ausnahme könnte es lediglich im Bereich der Selbstverwaltung der Gemeinden geben, wo jedoch grundsätzlich ebenfalls nur eine Administrativinstanz bestehen sollte (im Gemeindebereich wäre unter den Rahmenbedingungen der Berufungsvorentscheidung – Zweimonatsfrist, Vorlageantrag ohne Begründung – eine Art aufsichtsbehördliche Zwischenschaltung denkbar). Einigkeit bestand weiters darin, dass innerhalb der Verwaltungsgerichtsbarkeit grundsätzlich ein kontradiktorisches Verfahren eingeführt werden solle: Sowohl vor dem Verwaltungsgericht erster Instanz als auch vor dem Verwaltungsgerichtshof stehen einander Beschwerdeführer, sonstige Verfahrensparteien und Verwaltungsbehörde gegenüber; gegen die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte erster Instanz kann jede dieser Parteien den Verwaltungsgerichtshof anrufen; Gegenstand des Verfahrens des Verwaltungsgerichtshofs ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichts erster Instanz und nicht der Bescheid der Verwaltungsbehörde.
IV) 1) b) Einführung des Modells „9“ („nur“ 9
Landesverwaltungsgerichte) oder des Modells „9 + 1“ (9
Landesverwaltungsgerichte und ein Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz)?
Das Modell „9 + 1“ (9 Landesverwaltungsgerichte und ein Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz) ist konsentiert, weil sowohl bestimmte Sondermaterien (wie etwa das Fremdenrecht einschließlich der Schubhaftprüfung) als auch bestimmte bereits jetzt bestehende „Sondergerichte“ (wie etwa der Unabhängige Bundesasylsenat, der Bundeskommunikationssenat oder auch die Bundesagrarsenate) die Einrichtung eines zentralen Verwaltungsgerichts des Bundes 1. Instanz erforderlich machen (wobei es auch mehr als 9 Landesverwaltungsgerichte und mehr als ein Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz, etwa aufgrund des zu einem Gericht auszugestaltenden UFS, geben könnte). Dem entsprechend sollten die zahlreichen derzeit bestehenden Art 133 Z 4 B-VG-Behörden nach Möglichkeit zum Teil in die neuen Landesverwaltungsgerichte und zum Teil in die Verwaltungsgerichtsbarkeit des Bundes 1. Instanz eingegliedert werden. Unter Zugrundelegung der von Grabenwarter und Holoubek entwickelten Typologie[14] sollten die der Rechtskontrolle dienenden und die als „Strafbehörden“ fungierenden Kollegialbehörden in die neuen Verwaltungsgerichte eingegliedert werden, während die primär der Verwaltungsführung dienenden Kollegialbehörden jedenfalls „draußen bleiben“ sollten.[15] In den Verwaltungsgerichten sollten einerseits Einzelrichter und andererseits 3-Richter-Senate sowie schließlich Fachsenate (mit Expertenbeteiligung) entscheidungsbefugt sein.
IV) 1) c) VwGH als reines Revisionsgericht? Ablehnungsmodell oder
Zulässigkeitsmodell?
In der Arbeitsgruppe besteht im Wesentlichen Konsens darüber, dass für den Fall der Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit der VwGH als reines Revisionsgericht für die Entscheidung von Rechtsfragen des Verfahrensrechts und des materiellen Rechts von erheblicher Bedeutung eingerichtet werden sollte. Zur Entlastung des VwGH und im Sinne der Parteien und der rechtsuchenden Bevölkerung überhaupt sollte – insbesondere auch zur Erreichung einer kürzeren Verfahrensdauer – der Zugang zum VwGH beschränkt werden. Es sollte also in Zukunft gegen Verwaltungsbescheide keine Beschwerdemöglichkeit an den VwGH mehr geben.
Dies sollte auch für Beschwerden gegen Bescheide von Bundesministern gelten, für die in 1. Instanz weder der VwGH noch das Landesverwaltungsgericht Wien, sondern vielmehr das neu einzurichtende Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz zuständig sein sollte.
Letztlich konnte auch Konsens für die Einführung des Zulässigkeitsmodells erzielt werden, wobei die Parteien zwar zunächst nur den Zulässigkeitsausspruch beim VwGH bekämpfen, jedoch gleichzeitig die Revision gegen die gesamte Entscheidung (auch ihrem materiellen Inhalt nach) ausführen müssten (die Regelung von Details könnte auch dem Verfahrensgesetzgeber überlassen werden). Dazu kommt, dass das Zulässigkeitsmodell den Beschwerdeführer zu einer treffsichereren Argumentation zwinge und insofern auch eine gewisse prohibitive Wirkung haben sollte. Dies wird insbesondere auch von den Vertretern der ordentlichen Gerichtsbarkeit bestätigt, die nach Einführung des Zulässigkeitsmodells in der ZPO einen gewissen Anfallsrückgang festgestellt haben. Schließlich sollte sich auch die durch die Einführung des Zulässigkeitsmodells zu erwartende zeitliche Verzögerung (im Vergleich zum Ablehnungsmodell) in engen Grenzen halten. Freilich müsste – sollte das Zulässigkeitsmodell verwirklicht werden – die nachprüfende Kontrolle des Zulässigkeitsausspruches durch den VwGH gewährleistet sein.
IV) 1) d) Zukünftiges Schicksal der Art 133 Z 4 B-VG-Behörden
(Beibehaltung oder „Aufgehen lassen“ in zukünftigen Verwaltungsgerichten erster
Instanz)?
Diesbezüglich wird auf die Ausführungen unter Punkt V) des Berichts verwiesen.
IV) 1) e) Zukünftiges Verhältnis zwischen VfGH und VwGH?
Diesbezüglich wird auf die Ausführungen unter Punkt III) 1) des Berichts verwiesen.
IV) 1) f) Bundesweit einheitliches Verfahrensrecht für alle
Landesverwaltungsgerichte und das Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz?
Grundsätzlich herrscht in der Arbeitsgruppe Konsens darüber, dass es ein bundeseinheitliches Verfahrensrecht für alle Landesverwaltungsgerichte und die Verwaltungsgerichtsbarkeit des Bundes 1. Instanz geben sollte (die Finanzgerichtsbarkeit wird von diesem einheitlichen Verfahrensrecht wohl auszunehmen sein); zur Erlassung dieses Verfahrensrechts sollte der Bundesgesetzgeber zuständig sein. Jedoch wird die Frage, wer für die Erlassung jener Regelungen zuständig sein sollte, mit denen die einzelnen Materien bzw Angelegenheiten den Landesverwaltungsgerichten bzw dem Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz zugewiesen werden (der Bundesgesetzgeber als Materiengesetzgeber oder die Landesgesetzgeber als Organisationsgesetzgeber?), unterschiedlich beantwortet.
Von mehreren Sitzungsteilnehmern wurde auf die Bedeutung und die Notwendigkeit der Raschheit des durchzuführenden Verfahrens hingewiesen; in diesem Zusammenhang wurde einerseits die Forderung nach Einführung eines einstweiligen Rechtsschutzes (einstweilige Verfügung) erhoben; andererseits wurde auch ein Fristsetzungsmodell ins Spiel gebracht, das in einer ersten Stufe Fristsetzungsanträge beim Landesverwaltungsgericht bzw beim Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz sowie später beim VwGH und in einer zweiten Stufe ein Schadenersatzmodell (wie dies der EGMR bereits ausgesprochen hat) vorsehen könnte. Es müsste jedenfalls für die jeweils betroffene Gebietskörperschaft als Rechtsträger einen finanziell nachteiligen (und spürbaren) Effekt haben, wenn ein Verfahren über viele Monate oder gar Jahre verzögert wird.
In der Arbeitsgruppe besteht weiters Konsens darüber, dass die zur Anrufung der neu zu schaffenden Verwaltungsgerichte berechtigenden Anfechtungsgegenstände – wie schon bisher – einerseits Bescheide und andererseits Akte unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Maßnahmen) sein sollten. Darüber hinaus wurde jedoch die Forderung erhoben, diesen Katalog um die so genannten „Eingriffe“ in subjektive Rechte von einzelnen Rechtsunterworfenen durch die Staatsgewalt zu erweitern: diese könnten Informations-, Unterlassungs- und situative Eingriffe oder auch faktische Verwaltungsakte und staatliche Warnungen sein. Auch unterlassene Maßnahmen könnten als Ausdruck einer faktischen Amtsgewalt Eingriffe in die Rechte der Bürger sein und müssten daher als solche bekämpfbar sein. Dieser neu erhobenen Forderung wurde zwar grundsätzlich zugestimmt, es wurde jedoch mehrheitlich darauf hingewiesen, dass ein sachgerechter Einbau dieser neu zu definierenden „Eingriffe“ in das gegenwärtige System notwendig sei und dass grundsätzlich an die bestehenden Instrumentarien angeknüpft werden sollte. Es besteht zumindest insoweit Konsens, als die im geltenden Recht bestehende Typengebundenheit grundsätzlich beibehalten, jedoch um neue Formen des Verwaltungshandelns – behutsam – erweitert werden sollte.
IV) 1) g) Zukünftiges Schicksal der Unabhängigen Verwaltungssenate?
Grundsätzlich sollten die derzeit bestehenden Unabhängigen Verwaltungssenate (im Folgenden kurz: UVS) in die neu zu schaffenden Landesverwaltungsgerichte und der Unabhängige Bundesasylsenat (im Folgenden kurz: UBAS) in das neu zu schaffende Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz vollständig integriert werden.
Hinsichtlich der Ernennung der zukünftigen Richter der Verwaltungsgerichte der Länder und des Verwaltungsgerichts des Bundes 1. Instanz zeichnete sich Konsens dahingehend ab, dass diese Gerichte (Landesverwaltungsgerichte, Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz) zur Versachlichung der Entscheidungsfindung durch das Recht auf Erstattung von Besetzungsvorschlägen in das Auswahlverfahren eingebunden werden sollten; eine Einbindung von VwGH und OGH erscheint – nach Meinung der Mehrheit im Ausschuss – für die Ersternennung der zukünftigen Verwaltungsrichter im Zuge der Einführung der (Landes)Verwaltungsgerichtsbarkeit unabdingbar. Für die spätere Ernennung von weiteren Verwaltungsrichtern wäre ein Recht auf Stellungnahme durch diese Höchstgerichte – so die Mehrheitsmeinung im Ausschuss – ebenfalls wünschenswert. Wenngleich nicht alle bisherigen UVS-Mitglieder en bloc in die zukünftige Verwaltungsgerichtsbarkeit übernommen werden sollten, es insbesondere keine zwingende Automatik dafür geben sollte und die Möglichkeit bestehen bleiben muss, bisherige UVS-Mitglieder, die sich in der Vergangenheit nicht bewährt haben, nicht zu übernehmen, war man sich im Ausschuss doch weitestgehend im klaren darüber, dass sich die zukünftigen Verwaltungsgerichte wohl zum überwiegenden Teil aus den bisherigen UVS-Mitgliedern – uU auch solchen aus anderen Bundesländern – zusammensetzen werden. Dabei müsste eine allfällige Nicht-Übernahme mit Bescheid ausgesprochen werden und könnte als Kriterium für die Nicht-Übernahme von UVS-Mitgliedern zu Richtern der Verwaltungsgerichte, ähnlich wie schon derzeit bei der Definitivstellung von Universitätsassistenten, eine Prognoseentscheidung vorgesehen werden, dass die bisherige Tätigkeit als UVS-Mitglied nicht erwarten lasse, dass er/sie sich in Hinblick auf das geänderte Anforderungsprofil in Zukunft als Richter/Richterin des Verwaltungsgerichts bewähren würde (hier könnte § 33 Abs 2 iVm § 54 Abs 1 Richterdienstgesetz [RDG] als Vorbild dienen).
Ein bisheriges, nicht übernommenes UVS-Mitglied sollte jedenfalls einen wirksamen Rechtsschutz (in Form eines rechtsstaatlichen Verfahrens mit Bescheiderlassung und der Möglichkeit der Bekämpfung dieses Bescheids vor dem VwGH mittels Beschwerde) genießen und für den Fall der endgültigen Nicht-Übernahme wirtschaftlich abgesichert werden, es sei denn, dass der Grund für die Nicht-Übernahme in einer rechtskräftigen disziplinarrechtlichen Verurteilung liegt. Für den Fall, dass ein bisheriges UVS-Mitglied nicht in das Verwaltungsgericht übernommen werden sollte, muss eine solche Ausnahme zwar möglich sein, die diesbezügliche Entscheidung der Landesregierung aber begründet werden. Eine Blockübernahme der bisherigen UVS-Mitglieder wird schon deshalb nicht möglich sein, weil ja auch Bewerber von außen, insbesondere eine – prozentuell nicht näher zu bestimmende – Beteiligung von Berufsrichtern wünschenswert ist.
Was die Frage der Richterbeteiligung betrifft, herrschte im Ausschuss aufgrund der langjährigen positiven Erfahrungen beim VwGH Konsens darüber, dass Berufsrichter aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit – aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer größeren (auch inneren) Unabhängigkeit – in die Verwaltungsgerichte aufgenommen werden sollten. Kein Konsens konnte über eine bestimmte, zahlenmäßig oder prozentuell festgelegte Richterquote erzielt werden, wenngleich von mancher Seite betont wurde, dass gerade eine solche nähere (zahlenmäßige oder prozentuelle) Festlegung als Signal bzw als besonderer Akzent notwendig wäre, um eine solche Richterbeteiligung auch tatsächlich zu erreichen. Die überwiegende Mehrheit im Ausschuss ist aber der Meinung, dass die Richterbeteiligung an sich als Soll-Bestimmung in die neue Verfassung aufgenommen werden sollte, wobei als Vorbild Art 129b Abs 1 letzter Satz B-VG[16] dienen könnte, sodass die neue Bestimmung wie folgt lauten könnte:
„Wenigstens der vierte [dritte, fünfte] Teil der
Mitglieder [der Landesverwaltungsgerichte und des Bundesverwaltungsgerichts
erster Instanz] soll aus Berufsstellungen im Bund, vorwiegend [bevorzugt] aus
der ordentlichen Gerichtsbarkeit, entnommen werden.“
In diesem Zusammenhang wurde auch die Auffassung vertreten, dass bei der ersten Bestellung von Verwaltungsrichtern erster Instanz eine solche Bestimmung nicht gelten sollte, wenn sie sich dahingehend auswirken sollte, dass eine entsprechende Anzahl von Mitgliedern der UVS nicht in die Verwaltungsgerichte erster Instanz übernommen werden könnte.
Die Frage, ob die zu erstattenden Besetzungsvorschläge relative Bindungswirkung haben sollten, wurde nicht einhellig beantwortet. Es besteht in der Arbeitsgruppe nur insoweit ein gewisser Konsens, als eine einheitliche Vorgangsweise in der ordentlichen Gerichtsbarkeit einerseits und der zukünftigen Verwaltungsgerichtsbarkeit andererseits angestrebt werden sollte: Während jedoch die einen der Meinung sind, dass sich das bisherige Bestellungsverfahren im Justizbereich (keine „relative“ Bindungswirkung der Besetzungsvorschläge der Personalsenate gegenüber dem Justizminister) bewährt habe und dieses Verfahren auch in Zukunft für die Verwaltungsgerichte gelten solle (vgl Art 86 B-VG), traten die anderen dafür ein, die nunmehr für die zukünftigen Verwaltungsgerichte notwendig werdende Regelung der Bindungswirkung zum Anlass zu nehmen, auch die Besetzungsvorschläge der Personalsenate im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Zukunft verbindlich zu machen (zumal diese Personalsenate aufgrund der alle vier Jahre durchzuführenden Personalsenatswahlen auch in hohem Maße berufsständisch legitimiert seien). Um das Gesamtprojekt bzw das Ziel einer rechtsstaatlichen Verbesserung im Bereich der (vorwiegend) 2. Instanz nicht zu gefährden, zeichnete sich zuletzt eine Zustimmung zum Verzicht auf bindende Dreiervorschläge ab. Das in der ordentlichen Gerichtsbarkeit so gut wie nicht (und schon lange nicht mehr) in Anspruch genommene Abweichen vom Besetzungsvorschlag zu Gunsten einer/eines Nichtnominierten wurde – wie bereits erwähnt – von einigen Ausschussmitgliedern als präventiv wirkende „Notbremse“ gesehen.[17]
Ein gewisser Konsens konnte auch dahingehend erzielt werden, dass die besoldungsrechtliche Frage insofern von großer Wichtigkeit sei, als die – mit der Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu erzielende – höhere Qualität der Entscheidungen der Verwaltung sich auch in einer entsprechend höheren Besoldung widerspiegeln müsse; diese besoldungsrechtliche Frage ist aber nicht in der Verfassung, sondern nur auf einfach gesetzlicher Ebene zu regeln.
Schließlich besteht hinsichtlich der Ausbildung der zukünftigen Richter der Landesverwaltungsgerichte und des Verwaltungsgerichts des Bundes 1. Instanz eine gewisse Einigkeit darüber, dass diese möglichst gut ausgebildet sein sollten (das heißt nicht nur das Diplomstudium der Rechtswissenschaften abgeschlossen, sondern nach Möglichkeit zusätzliche Qualifikationen erworben haben sollten) und dass die Ausbildungsphase mit einer (Art von Dienst-) Prüfung abgeschlossen werden sollte. Die Frage, welche Ernennungsvoraussetzungen in fachlicher Hinsicht im Detail aufgestellt werden sollten, ob man insbesondere – wie etwa derzeit in Art 134 Abs 3 B-VG für die Mitglieder des VwGH vorgesehen – auch für die zukünftigen Verwaltungsrichter die Ausübung einer Berufsstellung über einen bestimmten Mindestzeitraum (zB von 5 Jahren) fordern sollte, für die der Abschluss der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien zwingend vorgeschrieben ist, wurde noch nicht abschließend beantwortet.
IV) 1) h) Möglichkeit der Erhebung einer Säumnisbeschwerde bei
Untätigkeit der Verwaltungsgerichte erster Instanz?
In der Arbeitsgruppe bestand Einigkeit darüber, dass eine Säumnisbeschwerde nach Vorbild des Art 132 B-VG ausschließlich für das Verhältnis zwischen (säumiger) Verwaltungsbehörde und VwGH konzipiert worden sei und auch nur für dieses Verhältnis „passe“. Nicht geeignet ist jedoch die analoge Anwendung dieser Bestimmung auf das Verhältnis zwischen Gerichten untereinander, also etwa zwischen den einzurichtenden Verwaltungsgerichten und dem VwGH. Aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben (Recht auf den gesetzlichen Richter, feste Zuständigkeitsverteilung, feste Geschäftsverteilung etc) kommt eine Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse auf den VwGH im Fall der Säumigkeit des Verwaltungsgerichts nicht in Frage. Schließlich wäre es – was von den Vertretern der ordentlichen Gerichtsbarkeit nachdrücklich unterstrichen wird – auch undenkbar, dass etwa im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Fall der Säumigkeit etwa eines Bezirksgerichts die Entscheidungsbefugnis auf den übergeordneten Gerichtshof überginge.
Schließlich konnte auch Konsens darüber erzielt werden, dass im Verhältnis zwischen den zukünftigen Verwaltungsgerichten und dem VwGH nicht auf das bestehende Instrument der Säumnisbeschwerde zurückgegriffen, sondern vielmehr ein Aufsichtsrecht des VwGH über die ihm untergeordneten Verwaltungsgerichte etabliert werden sollte: Dabei sollte der VwGH in einem ersten Schritt dem säumigen Verwaltungsgericht eine bestimmte Frist setzen und – nach Meinung mancher, jedoch bei weitem nicht aller Ausschussmitglieder – in einem zweiten Schritt – im Fall der Verletzung bzw Überschreitung dieser Frist (nach allfälliger Fristverlängerung) – eine Geldbuße gegen den jeweiligen Rechtsträger (Bund oder Länder) verhängen können. Dabei könnten die Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes analog herangezogen werden. Ob dann im Innenverhältnis ein Regressanspruch gegen die für die Säumnis verantwortlichen Mitglieder des Verwaltungsgerichts nach den Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes geltend gemacht wird, bliebe dem schuldig gesprochenen Rechtsträger vorbehalten.
Schließlich wurde auch vorgeschlagen, es könnte für den Fall der Säumnis von Höchstgerichten – als wirksame Beschwerdemöglichkeit im Sinne des Art 13 EMRK (vgl EGMR-Urteil im Fall „Kudla gegen Polen“) – ein besonderes höchstgerichtliches Organ eingerichtet werden.
IV) 1) i) Einbeziehung der Finanzgerichtsbarkeit in die zukünftige
Landesverwaltungs-gerichtsbarkeit?
In der Arbeitsgruppe konnte einerseits Konsens darüber erzielt werden, dass die vollständige organisatorische Eingliederung der Finanzgerichtsbarkeit in die neu zu errichtenden Verwaltungsgerichte zum jetzigen Zeitpunkt nicht praktikabel und auch nicht klug wäre, zumal dadurch das gesamte Reformprojekt der Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit gefährdet werden könnte. Andererseits war man sich darin einig, dass – schon aus Vereinheitlichungsgründen – in der Finanzgerichtsbarkeit dieselben rechtsstaatlichen Standards wie bei den neu zu errichtenden Verwaltungsgerichten herrschen sollten und dass gerade in der Finanzgerichtsbarkeit – auch aufgrund der dort sehr oft auftretenden handelsrechtlichen Probleme – die Beteiligung von Justizrichtern besonders wichtig wäre. Die organisatorische Eingliederung des Unabhängigen Finanzsenats in die zukünftigen Verwaltungsgerichte sollte allenfalls langfristig in Angriff genommen werden; dabei könnte man sich hinsichtlich der Größe und der Zahl auch an den seinerzeitigen Finanzlandesdirektionen orientieren.
IV) 1) j) Beibehaltung der Sonderrolle der Bundeshauptstadt Wien
(als Landeshauptstadt und Bundesland)?
Hier wurde von manchen die Meinung vertreten, dass die Sonderstellung Wiens nur historisch erklärbar sei und in einer künftigen Verfassung entfallen solle. Dem gegenüber wurde jedoch auch die Forderung erhoben, die Sonderstellung Wiens als Bundesland und Ortsgemeinde ebenso beizubehalten wie die für Wien eingerichteten „Sonderbehörden“, wie etwa die Abgabenberufungskommission und die Bauoberbehörde (vgl Art 111 B-VG) und den Landesvergabekontrollsenat (vgl Art 14b Abs 2 B-VG). Wieder andere meinten, dass die Frage des weiteren Schicksals der für Wien eingerichteten Sonderbehörden von der grundsätzlichen Entscheidung über die zukünftige Stellung Wiens abhänge. Als Kompromiss wurde vorgeschlagen, allen Ländern die Möglichkeit zur Errichtung besonderer Verwaltungsgerichte zu eröffnen, gegebenenfalls mit der Bindung an bestimmte Materien. Dieser Vorschlag fand weitgehend Zustimmung.
IV) 1) k) Art der Entscheidungsbefugnis der zukünftigen
Landesverwaltungsgerichte: Kassation oder Reformation?
Hier besteht in der Arbeitsgruppe Konsens darüber, dass die Verwaltungsgerichte in Zukunft – schon aus praktischen Erwägungen und um überflüssige Verfahrensverzögerungen zu vermeiden – grundsätzlich reformatorisch entscheiden sollen, dass sie jedoch darüber hinaus – nach Vorbild des geltenden § 66 Abs 2 AVG – auch die Möglichkeit zur kassatorischen Entscheidung haben sollten. Auch seitens der Ländervertreter wird dem Modell der Reformatorik zugestimmt, dies jedoch unter der Bedingung, dass die schon bisher der Landesregierung eingeräumte Möglichkeit der Erhebung einer Amtsbeschwerde beim VwGH gemäß Art 131 Abs 1 Z 3 B-VG auch in Zukunft gegen Entscheidungen der Landesverwaltungsgerichte möglich sein solle (gleiches müsse natürlich auch für die Bundesregierung im Fall von Entscheidungen des Verwaltungsgerichts des Bundes 1. Instanz gelten). Diese Bedingung findet in der Arbeitsgruppe einhellige Zustimmung, jedoch mit der Einschränkung, dass es bei den nach dem derzeitigen System bestehenden Zugangsbeschränkungen bleiben solle. Was den VwGH betrifft, sollte es bei dessen kassatorischer Entscheidungsbefugnis bleiben.
Einigkeit besteht in der Arbeitsgruppe auch darüber, dass viel schwieriger und für die Praxis bedeutender als die Unterscheidung zwischen Kassatorik und Reformatorik die Frage nach dem freien Ermessen sei, die derzeit in Art 130 Abs 2 B-VG geregelt ist. Auch in Zukunft sollte die Verwaltungsbehörde bei der Ausübung des ihr eingeräumten Ermessens frei sein; insoweit hätten die Verwaltungsgerichte mit Kassation vorzugehen.
Von
einer Seite thematisiert, jedoch im Ausschuss noch nicht im Detail erörtert
wurde das Problem, wer in Zukunft die Kosten von Sachverständigen (für die
Erstattung von Gutachten) in Verfahren vor den neuen Verwaltungsgerichten
erster Instanz tragen solle. Hier sei zu bedenken, dass die
Berufungswerber/innen bisher dort keine Kosten zu tragen gehabt hätten, wo
Amtssachverständige zur Verfügung gestanden sind. Für die Zukunft sollte
sichergestellt sein, dass die Verwaltungsgerichte erster Instanz nicht mit externen
Gutachtern arbeiten müssen, sondern auf Sachverständige der
Gebietskörperschaften zurückgreifen können.
Exkurs: Weisungsbeschwerde gemäß Art 81a Abs 4 B-VG
Der Vorschlag, das in Art 81a Abs 4 B-VG verankerte Recht der Schulbehörde, gegen eine an sie gerichtete Weisung Beschwerde beim VwGH zu erheben, ersatzlos zu streichen, da von diesem Recht in den letzten Jahrzehnten – soweit überblickbar – nie Gebrauch gemacht worden sei, fand in der Arbeitsgruppe unter der Voraussetzung einhellige Zustimmung, dass Konsens über die Reform der Schulverwaltung erzielt werden kann.
Zusammenfassend ist zum Thema „Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz“ festzuhalten, dass der judizielle Einschlag der künftigen Verwaltungsgerichte gegenüber den derzeitigen UVS, dem UBAS und dem UFS betont werden sollte. In diesem Sinne sollten VwGH und OGH bei der Ernennung der künftigen Verwaltungsrichter, zumindest bei der Ersternennung, eingeschaltet, Berufsrichter beteiligt und alle Verwaltungsrichter – ganz generell und auf verfassungsrechtlicher Stufe abgesichert – auf Dauer ernannt werden.
IV) 2) Kostentragung
Im Ausschuss wird einhellig die Meinung vertreten, dass die (für die Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit so wichtige) Kostentragungsproblematik im Ausschuss 9 vorläufig ausgeklammert bleiben und vom Ausschuss 10 diskutiert und gelöst werden sollte.
V) Sondersenate
Das Thema „Sondersenate“ – also Kollegialbehörden mit richterlichem
Einschlag und sonstige weisungsfreie Verwaltungsbehörden – war Gegenstand
mehrerer Sitzungen der „kleinen Arbeitsgruppe“, insbesondere jener vom
26.1.2004, sowie der Ausschusssitzung vom 13.2.2004.
Wie bereits im Allgemeinen Teil ausgeführt, wurde von der Ausschussbetreuung – auf der Grundlage der einschlägigen Vorarbeiten von Grabenwarter in Korinek/Holoubek, Kommentar zum B-VG (Loseblattsammlung), und Lanner, Kodex Verfassungsrecht, 19. Auflage, 2003 – eine aktualisierte Liste über die derzeit bestehenden Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag gemäß Art 133 Z 4 B-VG und die sonstigen weisungsfreien Verwaltungsbehörden und Organe ausgearbeitet und mit Schreiben vom 23.12.2003 an das Bundeskanzleramt/Verfassungsdienst (für den Bundesbereich) und an alle Ämter der Landesregierungen (für die jeweiligen Länder) mit der Bitte um Durchsicht und allfällige Ergänzung versendet. Es haben alle angeschriebenen Ämter geantwortet und – zum Teil umfangreiche – ergänzende Stellungnahmen erstattet. Diese Stellungnahmen wurden in der Zwischenzeit in die Liste eingearbeitet, die nunmehr – vollständig ergänzt und aktualisiert – diesem Bericht am Ende (unter Punkt „C. Anhang“) angeschlossen ist. Die Liste wurde auch insofern erweitert, als für jede einzelne Behörde vorgeschlagen wurde, ob diese in die neuen Verwaltungsgerichte „eingebaut“ werden sollte oder nicht (wobei zwar nach dem Grundsatz vorgegangen wurde, möglichst viele Behörden in die neuen Verwaltungsgerichte „einzubauen“, jedoch einerseits gewisse Typen von „Behörden und Organen“, wie etwa bloße Schiedskommissionen oder auch bestimmte Beauftragte mit bloß gutachterlicher Funktion, und andererseits bestimmte materiellrechtliche Bereiche, wie etwa das Dienst-, Disziplinar- und Vergaberecht, bewusst ausgeklammert wurden).
In der Arbeitsgruppe bestand weitgehend Einigkeit darüber, dass keine neuen Art 133 Z 4 B-VG-Behörden geschaffen und – nach Fixierung der Grundlagen über die zukünftige Einführung der (Landes-)Verwaltungsgerichtsbarkeit – die bestehenden Kollegial- und Sonderbehörden „durchforstet“ werden sollten, wobei die Sonderbehörden mit Kontroll- oder Schiedsfunktionen und die Kontrollbehörden als Strafbehörden 1. Instanz vom Ausschuss 9, die lediglich der Verwaltungsführung dienenden Behörden (die so genannten „Regulatoren“) jedoch vom Ausschuss 7 zu behandeln sind. Zunächst wollte man für jede einzelne vom Ausschuss 9 zu behandelnde Behörde entscheiden, ob diese in die neu zu schaffenden Landesverwaltungsgerichte bzw das Bundesverwaltungsgericht 1. Instanz eingegliedert werden oder aber – neben diesen – weiterhin selbständig bestehen bleiben sollte.
Da sich eine solche Vorgangsweise angesichts der Vielzahl und der Heterogenität der zu „durchforstenden“ Behörden und der Knappheit der zur Verfügung stehenden Zeit als nicht praktikabel erwies, einigte man sich in der Arbeitsgruppe schließlich darauf, zunächst – in einem ersten Schritt – nur gewisse Grundlinien für die geplante Integration einzelner Behörden zu entwickeln und erst in einem zweiten Schritt die Entscheidung im Einzelfall zu treffen, dies jedoch erst nach vorheriger Einbeziehung der betroffenen Behörden bzw Behördenmitglieder. Diesbezüglich stieß die Anregung, von Seiten des Konvents-Büros Anfragen zumindest an alle Ämter der Landesregierungen und an alle zuständigen Bundesministerien (oder sogar auch an die Behörden selbst) zu stellen, auf allgemeine Billigung; solche Anfragen werden nach Abgabe dieses Berichts gestellt werden.
Hinsichtlich der erwähnten „Grundlinien“ bestand in der Arbeitsgruppe weitgehend Konsens darüber, dass es in Zukunft grundsätzlich folgende Typen von Verwaltungsgerichten bzw Behörden geben solle:
- zum ersten Landesverwaltungsgerichte und ein Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz, in die – dem Ziel der Vereinheitlichung entsprechend – möglichst viele der derzeit bestehenden Art 133 Z 4 B-VG-Behörden eingegliedert werden sollen und in denen auch Fachsenate mit Beisitzern und Laienrichtern gebildet werden sollen; so sollten jedenfalls die Unabhängigen Verwaltungssenate oder etwa auch die Landesgrundverkehrskommissionen und Landesagrarsenate in die zukünftigen Landesverwaltungsgerichte und der Unabhängige Bundesasylsenat oder etwa auch der Unabhängige Umweltsenat in das zukünftige Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz integriert werden;
- zum zweiten Sonderverwaltungsgerichte 1. Instanz (etwa durch Umwandlung des derzeit bestehenden Unabhängigen Finanzsenats);
- zum dritten weiterhin Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag gemäß Art 133 Z 4 B-VG in sachlich begründeten Ausnahmefällen, insbesondere dort, wo sich diese in der Vergangenheit bewährt haben (etwa die Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter) und wo der Weiterbestand sachlich gerechtfertigt ist (etwa wegen des speziellen Fachwissens der Mitglieder [etwa im Telekommunikations- und Wettbewerbsrecht] oder wegen der Notwendigkeit der besonderen Raschheit des Verfahrens [etwa im Vergaberecht] oder wegen der Notwendigkeit bundeseinheitlicher Regelungen [etwa im Datenschutzrecht]); deren Entscheidungen unterliegen jedoch wie die Entscheidungen aller anderen Behörden der nachprüfenden Kontrolle des Verfassungs- und des Verwaltungsgerichtshofs; und
- zum vierten weisungsfreie Behörden und Organe (die entweder verfassungsgesetzlich oder einfachgesetzlich weisungsfrei gestellt sind), wobei stets die Kontrolle auch durch den Verwaltungsgerichtshof vorgesehen werden sollte. In diesem Zusammenhang sind etwa die Wahlbehörden, die Schiedskommissionen (nach dem Krankenanstaltenrecht) oder auch die dienst- und disziplinarrechtlichen Behörden und Kommissionen zu nennen, die sich für eine Eingliederung in die zukünftige Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht eignen.
Was das weitere Schicksal der Art 133 Z 4 B-VG-Behörden betrifft, bestand zwar grundsätzlich Konsens darüber, dass es solche auch in Zukunft geben werde müssen; von manchen Ausschussmitgliedern wurde jedoch mit Nachdruck die Forderung nach Vereinheitlichung und Eingliederung möglichst vieler bestehender Art 133 Z 4 B-VG-Behörden erhoben. Dies könnte etwa in der Weise geschehen, dass dafür zunächst vom Verfassungsgesetzgeber eine Frist gesetzt wird, nach deren Verstreichen die Sonderbehörden grundsätzlich aufzulösen wären; nur ausnahmsweise und bei besonderem Bedarf, der jedoch von der jeweiligen Träger-Gebietskörperschaft in jedem Einzelfall argumentiert werden müsste, dürfte eine Art 133 Z 4 B-VG-Behörde aufrecht belassen werden. Hinsichtlich der genaueren Festlegung gingen die Meinungen aber auseinander: während die einen aus Gründen der Rechtssicherheit und Klarheit eine ausdrückliche (taxative) Verankerung jeder einzelnen derartigen Behörde in der Verfassung forderten, schlugen die anderen aus Gründen der Flexibilität und Praktikabilität vor, in der Verfassung lediglich allgemeine Kriterien zu formulieren, bei deren Erfüllung der Weiterbestand solcher Behörden zulässig sein sollte (wobei die einzelne Art 133 Z 4 B-VG-Behörde dann auf einfachgesetzlicher Grundlage vorgesehen werden können solle).
Kompetenzrechtlich könnte man nach Meinung eines Teils der Ausschussmitglieder die Frage, welcher Gesetzgeber für die Erlassung jener Regelungen zuständig sein sollte, mit denen die einzelnen Materien bzw Angelegenheiten den Landesverwaltungsgerichten bzw dem Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz (oder keinem von beiden) zugewiesen werden bzw mit denen die derzeit bestehenden Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag und die sonstigen weisungsfreien Verwaltungsbehörden entweder in die Landesverwaltungsgerichte oder in das Bundesverwaltungsgericht 1. Instanz (oder in keines von beiden) „eingebaut“ werden, mit Hilfe des Instruments der Art 15a B-VG-Vereinbarung lösen: Demnach sollte der Bundes(verfassungs)gesetzgeber für die Zuweisung von Bundesangelegenheiten an das neue Verwaltungsgericht des Bundes 1. Instanz zuständig sein. Die Landes(verfassungs)gesetzgeber sollten für die Zuweisung von Landesangelegenheiten an die neuen Landesverwaltungsgerichte zuständig sein, wobei durch eine Vereinbarung aller Bundesländer (unter Umständen auch einer qualifizierten Mehrheit von Bundesländern) die Eingliederung jetzt bestehender Kollegial- und Sonderbehörden in die zukünftigen Verwaltungsgerichte (mit Geltung für alle Bundesländer) erzielt werden sollte. Dabei könnte man – um dem föderalistischen Gedanken Rechnung zu tragen – zB nach Vorbild des Art 95 des EG-Vertrags in der Fassung des Vertrags von Nizza (ehemals Art 100a) einem Bundesland das Recht einräumen, eine spezielle ländereigene Regelung beizubehalten, wenn dies durch wichtige Erfordernisse sachlich gerechtfertigt ist.
Der in diesem Zusammenhang vorgeschlagene Übergangszeitraum von fünf Jahren (ab Inkrafttreten) wurde von manchen Mitgliedern aufgrund organisatorischer Bedenken als zu kurz, von manchen Mitgliedern aufgrund rechtsstaatlicher Überlegungen (Rechtsunsicherheit in der Umstellungsphase) als zu lang qualifiziert.
Von den Vertretern der Länder wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass diese Diskussion nicht losgelöst von der Frage geführt werden könne, welche Kompetenzen die Länder letztlich erhalten werden; insofern sei die gegenwärtige Diskussion in der Arbeitsgruppe maßgeblich von den Ergebnissen des Ausschusses 5 (Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern) abhängig. Die Ländervertreter regten jedoch an, unter Umständen den Bundesrat in diese Umstellungsproblematik einzubeziehen.
VI) Rechtsschutz – Erweiterung?
Das Generalthema „Rechtsschutz – Erweiterung?“ war Gegenstand der Ausschusssitzung vom 13.2.2004.
VI) 1) Zur Erweiterung des Rechtsschutzes durch Beiräte und
Rechtsschutzbeauftragte
Die – im Ausschuss erst am Ende thematisierte – Einrichtung von Beiräten bzw Rechtsschutzbeauftragten, die historisch im Strafprozessrecht ihren Ausgang nahm (vgl §§ 149n und 149o StPO) und später im Sicherheitspolizeirecht (vgl §§ 62 und 62a SPG) und im Militärbefugnisrecht (vgl § 57 MBG) weiter entwickelt wurde, gehört zu den interessantesten rechtsstaatlichen Neuerungen der letzten Jahre, zumal diese nach den Vorstellungen des Gesetzgebers die Rechtmäßigkeit von staatlich angeordneten Eingriffen in die Privat- und Freiheitssphäre des Einzelnen (ohne dass dieser davon Kenntnis hat) kontrollieren und Parteirechte an Stelle des Betroffenen wahrnehmen sollten. So wichtig diese Einrichtung ist, so problematisch erscheinen jedoch die Bestellung und die Stellung dieser Rechtsschutzbeauftragten aus verfassungsrechtlicher Sicht: deren Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit sind nämlich nur einfachgesetzlich (und zwar in den §§ 149n Abs 4 StPO, 62a Abs 4 SPG und 57 Abs 3 MBG) garantiert, sodass das „Damoklesschwert“ der verfassungsgerichtlichen Kontrolle (und uU Aufhebung) ständig über ihnen schwebt.[18]
Schon aufgrund des erst jüngst ergangenen Erkenntnisses des VfGH vom 23.1.2004, G 363/02-13, ergibt sich die Notwendigkeit, dass allein aus Gründen der Klarheit und Rechtssicherheit die jetzt lediglich im einfachen Gesetzesrang stehenden, mehr oder weniger gleich lautenden Bestimmungen („Der Rechtsschutzbeauftragte ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Er unterliegt der Amtsverschwiegenheit.“) auf verfassungsrechtliche Ebene zu heben sind.[19] In dem zitierten Erkenntnis hat der VfGH nämlich die Tätigkeit des Rechtsschutzbeauftragten nach dem MBG als „hoheitlich“ sowohl im materiellrechtlichen als auch im organisatorischen Sinn qualifiziert und einzelne Bestimmungen des MBG, darunter auch § 57 Abs 3 erster Satz MBG über den Rechtsschutzbeauftragten – mangels verfassungsrechtlicher Verankerung der Weisungsfreistellung bzw der Durchbrechung des in Art 20 Abs 1 B-VG angeordneten Weisungszusammenhangs – als verfassungswidrig aufgehoben. Die anstehende (zumindest teilweise) Reform der Verfassung mit einer uU tief greifenden Neuordnung des 6. Hauptstücks des B-VG über die Garantien der Verfassung und Verwaltung wäre wohl die ideale Gelegenheit und auch der richtige Zeitpunkt für eine verfassungsrechtliche Regelung der Stellung der Rechtsschutzbeauftragten: Dies könnte entweder in Form einer ausdrücklichen Verpflichtung, die Rechtsschutzbeauftragten weisungsfrei zu stellen, oder gleich in Form einer unmittelbaren Anordnung, etwa im 7. Hauptstück des B-VG, erfolgen.
Schließlich wurde in der Ausschusssitzung vom 13.2.2004 auch noch eine Neugestaltung des Menschenrechtsbeirats (derzeit allein für den Bereich der Sicherheitsbehörden eingerichtet) im Sinn einer Prüfungskompetenz auch im Bereich der Justizanstalten bzw die Schaffung eines gesonderten Gremiums mit gleichen Aufgaben in diesem Bereich diskutiert, für den derzeit allein die Strafvollzugskommissionen nach § 18 des Strafvollzugsgesetzes zuständig sind. Dabei war man sich weitgehend einig, dass die Unabhängigkeit der Mitglieder eines Beirats, der Bestellungsvorgang sowie die organisatorische Anbindung (Parlament oder Bundeskanzleramt?) verfassungsrechtlich – wiederum etwa im Siebten Hauptstück des B-VG – zu gewährleisten sind. Die Zuständigkeit eines Menschenrechtsbeirats für gerichtlich angeordnete Anhaltungen müsste sich auf die Überprüfung und Kontrolle der Haftbedingungen und mögliche Verbesserungen im Sinne eines präventiven Menschenrechtsschutzes, nicht aber auf eine individuelle Rechtmäßigkeitskontrolle der Entscheidungen unabhängiger Gerichte beziehen. Die Einrichtung eines oder mehrerer unabhängiger Beiräte wäre nach dem Fakultativprotokoll der Vereinten Nationen zum Übereinkommen gegen die Folter, das von Österreich in nächster Zeit ratifiziert werden soll, obligatorisch vorzunehmen.
VI) 2) Zum Problem der Staatshaftung bei Verletzung des
Gemeinschaftsrechts
Zu dem – im Ausschuss ebenfalls erst am Ende, nämlich vorwiegend in den Ausschusssitzungen vom 12.2.2004 und 27.2.2004 erörterten – Institut der Staatshaftung ist Folgendes vorauszuschicken:
Dieses Institut wurde durch die Judikatur des EuGH entwickelt. Zwar resultiert der Anspruch auf Staatshaftung aus der (einem Mitgliedstaat zuzurechnenden) Verletzung des Gemeinschaftsrechts und beruht insofern unmittelbar auf dem Gemeinschaftsrecht, doch ist es Sache der Mitgliedstaaten, im Rahmen ihrer Rechtsordnungen die Geltendmachung dieses Anspruchs sicherzustellen. In Österreich gibt es – abgesehen vom geltenden Amtshaftungsgesetz (AHG) – (noch) keine gesetzliche, insbesondere auch keine spezielle verfassungsgesetzliche Regelung für die Geltendmachung von Staatshaftungsansprüchen.
VI) 2) a) Zu den Anspruchsgrundlagen
Zu unterscheiden ist grundsätzlich zwischen exekutivem Unrecht (darunter versteht man – grob gesprochen – die Verletzung von Gemeinschaftsrecht durch das hoheitliche oder privatwirtschaftliche Tätigwerden von Verwaltungsbehörden), legislativem Unrecht (darunter versteht man – ebenso grob gesprochen – die Verletzung von Gemeinschaftsrecht durch das Tätigwerden oder das Untätigbleiben des nationalen Gesetzgebers) und schließlich judikativem Unrecht (darunter versteht man – wiederum grob gesprochen – die Verletzung von Gemeinschaftsrecht durch die Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte, uU auch der Höchstgerichte).
Einigkeit herrscht – in Rechtsprechung und Lehre ebenso wie im Ausschuss – darüber, dass für die Geltendmachung von Staatshaftungsansprüchen aufgrund exekutiven Unrechts die ordentlichen Gerichte zuständig sind.[20] Rein exekutives, aus hoheitlichem Handeln resultierendes Unrecht wird vom OGH nur unter dem Titel der Amtshaftung behandelt, die Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes (AHG) werden analog – durch eine Kombination aus dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts und dem Grundsatz der gemeinschaftsrechtskonformen Interpretation – angewendet.[21]
Hinsichtlich der Geltendmachung von Staatshaftungsansprüchen aufgrund legislativen Unrechts stellt sich die Judikatur von VfGH und OGH wie folgt dar:
aa) Der VfGH sprach – aufbauend auf VfSlg 16.107/2001 – zuletzt mit Erkenntnis vom 7.10.2003, A 11/01, zwar aus, dass Schadenersatzansprüche – auch wenn sie auf einem öffentlich-rechtlichen Titel beruhen – grundsätzlich im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen seien, dass Art 137 B-VG als Anspruchsgrundlage nur subsidiär in Frage komme und dass die Zuständigkeit für Staatshaftungsansprüche mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage nach den allgemeinen Grundsätzen der Zuständigkeitsverteilung vorzunehmen sei, dass aber eine Zuständigkeit des VfGH dann bestehe, wenn die anspruchsbegründenden Handlungen oder Unterlassungen nicht einem hoheitlich tätigen Vollzugsorgan oder einem privatrechtsförmig tätig gewordenen Staatsorgan, sondern unmittelbar dem Gesetzgeber zuzurechnen seien, etwa weil eine Ermächtigung eines Staatsorgans zu einer entsprechenden Tätigkeit gesetzlich (zB bei Untätigbleiben des Gesetzgebers bei der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht oder bei entschädigungsloser Legalenteignung) gar nicht vorgesehen ist.
ab) Hingegen hat es den Anschein, dass der OGH im Fall „Konle“ auch in einem Fall legislativen Unrechts eine Zuständigkeit für sich und die ordentlichen Gerichte beansprucht.[22]
VI) 2) b) Zur
Zuständigkeit und zum Verfahren
Geht man davon aus, dass es hinsichtlich der Geltendmachung von Staatshaftungsansprüchen neben exekutivem Unrecht auch noch legislatives Unrecht gibt, so ist daraus wohl der Schluss zu ziehen, dass bei ausschließlich exekutivem Unrecht die ordentlichen Gerichte zuständig sind, während bei (auch) legislativem Unrecht der VfGH zuständig ist. Für das Verfahren bedeutet dies, dass im Fall der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte die Bestimmungen des AHG – allenfalls analog – heranzuziehen sind, während im Fall der Zuständigkeit des VfGH Art 137 B-VG iVm den Bestimmungen des VfGG[23] die verfahrensrechtliche Grundlage bildet.
Was das „richtige“ Verfahren für die Geltendmachung von Staatshaftungsansprüchen aufgrund legislativen Unrechts anlangt, spricht für die Zuständigkeit des VfGH der Umstand, dass sich dieser auf Art 137 B-VG berufen kann und ihm innerhalb der drei Höchstgerichte die Zuständigkeit wohl dann zukommt, wenn es um die Beurteilung verfassungsrechtlicher Fragen (im weitesten Sinn) geht. Für die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte spricht dagegen, dass es sich auch bei Staatshaftungsansprüchen letztlich um Schadenersatzansprüche handelt und dass der dreigliedrige Instanzenzug der ordentlichen (Amtshaftungs-) Gerichtsbarkeit wohl dem VfGH als erster und einziger Instanz (und daher auch Tatsacheninstanz) vorzuziehen ist, auch wenn es sich de facto fast immer um Rechtsfragen handeln wird. Es wurde aber zu bedenken gegeben, dass jedenfalls bei der Feststellung der Schadenshöhe Fakten zu erheben und Feststellungen zu treffen sein werden.
VI) 2) c) Zum Sonderproblem des Staatshaftungsanspruchs aufgrund
einer fehlerhaften Entscheidung eines Höchstgerichts
ca) Die Frage, ob ein Staatshaftungsanspruch auch auf ein gemeinschaftsrechtswidriges Verhalten eines Höchstgerichts gestützt werden kann, ist durch das Erkenntnis des EuGH im so genannten Fall „Köbler“[24] bindend geklärt und bejaht worden. Auch der Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht in einer letztinstanzlichen Entscheidung kann – so der EuGH – einen Staatshaftungsanspruch begründen, wenn die verletzte Gemeinschaftsrechtsnorm bezweckt, dem Einzelnen Rechte zu verleihen, der Verstoß hinreichend qualifiziert ist und zwischen diesem Verstoß und dem dem Einzelnen entstandenen Schaden ein unmittelbarer Kausalzusammenhang besteht. Bei der Entscheidung darüber, ob der Verstoß hinreichend qualifiziert ist, muss das zuständige nationale Gericht, wenn sich der Verstoß aus einer letztinstanzlichen Gerichtsentscheidung ergibt, unter Berücksichtigung der Besonderheit der richterlichen Funktion prüfen, ob dieser Verstoß offenkundig ist. Es ist Sache der Rechtsordnung der einzelnen Mitgliedstaaten, zu bestimmen, welches (nationale) Gericht für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten über diesen Schadenersatz zuständig ist; diesbezüglich hat der EuGH sozusagen „den Ball an die Mitgliedstaaten zurückgespielt“.
cb) Die Frage, ob ein Staatshaftungsanspruch auf ein gemeinschaftsrechtswidriges Verhalten eines Höchstgerichts gestützt werden kann (und bejahendenfalls, welches nationale Gericht dafür innerstaatlich zuständig wäre), hat der OGH sowohl in 1 Ob 179/99a als auch in 1 Ob 146/00b offen gelassen.
cc) Der VfGH hat in VfSlg 16.107/2001 zwar grundsätzlich die innerstaatliche Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte anerkannt, jedoch eingeschränkt, dass „anderes in Ansehung des § 2 Abs 3 AHG iVm Art 137 B-VG gelten [mag] (was aber in diesem Verfahren dahingestellt bleiben kann).“ An dieses Grundsatzerkenntnis anknüpfend hat der VfGH nunmehr im Erkenntnis A 36/00 vom 10.10.2003 ausgesprochen, dass eine Nichtanwendung des § 2 Abs 3 AHG (der Amtshaftungsansprüche aufgrund von Erkenntnissen der Höchstgerichte ausschließt) zwar denkbar sei, „doch übersähe eine solche Argumentation, dass die Nichtanwendung positiven Gesetzesrechts zur Erreichung einer gemeinschaftsrechtskonformen Rechtslage nur dann in Frage kommt, wenn dieses Ziel nicht anders herbeigeführt werden kann. In concreto steht aber die – gemeinschaftsrechtlich jedenfalls unbedenkliche – Bestimmung des Art 137 B-VG zur Verfügung, der zufolge vermögensrechtliche Ansprüche gegen Gebietskörperschaften subsidiär vor dem Verfassungsgerichtshof geltend gemacht werden können. [...] Dort aber, wo sich der Staatshaftungsanspruch aus dem Gemeinschaftsrecht ergibt und das Gemeinschaftsrecht eine entsprechende Zuständigkeit eines mitgliedstaatlichen Organs zur Geltendmachung von Staatshaftungsansprüchen erfordert, steht die subsidiäre Zuständigkeit nach Art 137 B-VG zur Verfügung. Dies gilt für die Haftung, die aus dem Titel legislativen Unrechts geltend gemacht wird (vgl VfSlg 16.107/2001), genauso wie für die Haftung aus gemeinschaftsrechtswidrigen höchstgerichtlichen Entscheidungen.“ Auf diese Weise begründet der VfGH seine Zuständigkeit in dieser Sache.[25]
VI) 2) d) Besteht ein Bedarf an einer ausdrücklichen verfassungsgesetzlichen
Regelung?
da) Für eine ausdrückliche verfassungsgesetzliche Regelung der Staatshaftung spricht vor allem der Gedanke der Rechtssicherheit. In einem Rechtsstaat muss der Rechtsunterworfene – uU nach vorheriger juristischer Beratung – mit einer gewissen Sicherheit wissen, in welchem Verfahren und bei welchem Gericht er seine Ansprüche durchzusetzen hat. Die – niemals ganz auszuschließende – Gefahr, sich zu „verklagen“, muss möglichst gering gehalten werden.
Gegen eine ausdrückliche Regelung spricht vor allem das Argument, dass die Gefahr des Scheiterns des nationalen Gesetzgebers bei der Regelung eines sich gerade jetzt so dynamisch entwickelnden Rechtsstoffes relativ groß ist, zumal auch nach den jüngsten Erkenntnissen von EuGH und VfGH die Zuständigkeitsfrage zwischen den einzelnen Höchstgerichten – angesichts der Vielfalt der denkbaren Sachverhalte – nicht restlos geklärt ist und es insofern ratsam sein könnte, die Judikaturentwicklung noch ein wenig abzuwarten.
db) Sollte man sich zu einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung entschließen, müsste man zunächst eine kompetenzrechtliche Abklärung vornehmen: Es wäre die Schaffung einer eigenen Kompetenzgrundlage – nach dem jetzigen System wohl in Art 10 Abs 1 B-VG – notwendig, da aufgrund der derzeitigen Rechtslage weder der Bundesgesetzgeber allein noch die Landesgesetzgeber allein für die Regelung zuständig wären.[26]
dc) Weiters wäre eine systematische Abklärung dahingehend notwendig, ob man das bestehende AHG ergänzen oder ein völlig neues Staatshaftungsgesetz schaffen will. Grundsätzlich erscheint das bestehende amtshaftungsrechtliche Instrumentarium durchaus brauchbar, das AHG müsste aber entweder in einigen Punkten adaptiert werden (der Organbegriff des § 1 AHG [Gerichtsbarkeit und Verwaltung] müsste um die Gesetzgebung ergänzt werden; die „Rettungspflicht“ des § 2 Abs 2 AHG und der Haftungsausschluss des § 2 Abs 3 AHG müssten wohl überdacht werden) oder aber es müsste ein eigener Abschnitt (oder zumindest ein eigener Paragraph) über die analoge Anwendung des AHG auf Staatshaftungsansprüche eingefügt werden.
dd) Darüber hinaus wäre eine Abklärung der Zuständigkeit und des Verfahrens notwendig: Danach sollten die ordentlichen Gerichte aufgrund der Bestimmungen des (adaptierten) AHG über alle Fälle exekutiven Unrechts entscheiden; der VfGH sollte aufgrund des Art 137 B-VG iVm den Bestimmungen des VfGG lediglich für die (dem nationalen Gesetzgeber unmittelbar zurechenbaren) Fälle legislativen Unrechts zuständig sein, also im Wesentlichen für den Fall der mangelhaften oder nicht fristgerechten Umsetzung einer EU-Richtlinie durch den nationalen Gesetzgeber.
de) Zuletzt wäre zu überlegen, dass immer derjenige aktiv legitimiert wäre, der behauptet, anspruchsberechtigt zu sein; passiv legitimiert wäre im Fall von exekutivem oder legislativem Unrecht wohl jeweils jene Gebietskörperschaft, der der gemeinschaftsrechtliche Verstoß zuzurechnen ist. Das könnte im Fall von legislativem Unrecht etwa auch das Land wegen des Versäumnisses des Landesgesetzgebers sein.[27] Im Fall von judikativem Unrecht (aufgrund der fehlerhaften Entscheidung eines Höchstgerichts) wäre wohl immer der Bund (die Republik) passiv legitimiert.
df) Für die (in
der Praxis wohl seltenen) Fälle des judikativen Unrechts wurde vor dem
Hintergrund des sich auf höchstgerichtlicher Ebene anbahnenden (unter Punkt VI)
2) c) näher beschriebenen) Kompetenzkonflikts – wie dies bei der Herbsttagung
der Österreichischen Juristenkommission am 28.10.2003 in Wien angeregt wurde –
die Idee der Schaffung eines obersten, aus Mitgliedern aller drei
Höchstgerichte bestehenden Senats, eines so genannten „Austrägalsenats“, wieder
aufgegriffen, die in den 50er und 60er Jahren mit dem Ziel der
Vereinheitlichung der Rechtsprechung aller drei Höchstgerichte entwickelt wurde
und bis zum Stadium eines Entwurfs des Bundeskanzleramts/Verfassungsdienst
geführt hat.[28]
Die Übertragung
der Entscheidung auf ein weiteres „Grenzorgan“ lässt freilich auch die Frage
auftauchen, dass dieses wiederum staatshaftungsbegründende Fehler begehen
könnte.
Bislang konnte
im Ausschuss in Fragen der Staatshaftung keine Einigung erzielt werden. Auch
unter Bedachtnahme auf einen noch nicht publizierten Beitrag von Hon.-Prof. Dr.
Kurt Heller zum Thema der „Haftung des Staates für den Verstoß seiner
Höchstgerichte gegen Gemeinschaftsrecht“, in dem diese Problematik
differenzierter aufgearbeitet wird, als sie bislang im Ausschuss diskutiert
werden konnte, sollte die Frage weiter behandelt werden.
B. Besonderer Teil
Zu Punkt II) 3): Fragen zur Staatsanwaltschaft
Textvorschlag für eine neue Überschrift des Abschnitts B.
im Dritten Hauptstück des B-VG
In der Überschrift des Abschnitts B. des Dritten Hauptstücks wird das Wort „Gerichtsbarkeit“ ersetzt durch das Wort „Justiz“.
Erläuterungen: Die Staatsanwaltschaft ist in ihrer untrennbaren Verflechtung mit den (Straf-)Gerichten und als Teil der Funktionseinheit „Strafrechtspflege“ eine Justizbehörde. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung und gängigen Semantik ist sie Teil der Justiz. In materieller Betrachtung hat sie nichts zu „verwalten“, das heißt, keinen selbständigen Verwaltungsbereich zu administrieren, sondern das auf die Gerichte bezogene Anklagerecht und dessen negative Seite (Einstellungs- und Diversionsentscheidungen) auszuüben, letzteres in Überlappung mit gerichtlichen Entscheidungen.
Die Funktionstrennung zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht innerhalb des Strafverfahrens, die schon de lege lata durch mannigfache Verbindungen und Verflechtungen flankiert ist (zB richterliche Vorerhebungen im Auftrag des Staatsanwalts als Herrn des Verfahrens, Entscheidungen der Gerichte über Subsidiaranträge und –anklagen sowie Anklageeinsprüche), ist eine Folge des Anklagegrundsatzes, nicht des verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatzes. (Letzterer verbietet gerade die für das Strafverfahren typischen Funktionsverbindungen und –verflechtungen.) Art 94 B-VG spricht schon jetzt von der Trennung von „Justiz“ und Verwaltung (und nicht von der Trennung von „Gerichtsbarkeit“ und Verwaltung).
Die Überschrift des Abschnitts B. im Dritten Hauptstück des B-VG sollte daher besser „Justiz“ statt „Gerichtsbarkeit“ lauten. Dies würde die Justizbehörde Staatsanwaltschaft deutlicher einschließen und entspräche auch dem internationalen Sprachgebrauch („justiziell“, „judicial authority“, „autorité judiciaire“), der – etwa innerhalb der EU – gleichfalls jeweils die staatsanwaltschaftlichen Behörden einschließt.
Textvorschlag für einen neuen (nach dem jetzigen System) Art 90 Abs
3 B-VG
Dem Art 90 wird
folgender Abs 3 angefügt:
„(3) Die öffentliche Anklage sowie die justizielle Strafverfolgung obliegen den Staatsanwaltschaften. Durch Bundesgesetz ist die Stellung der Staatsanwälte als Organe der Justiz zu gewährleisten.“
Erläuterungen:
Zu Satz 1: Die
Staatsanwaltschaft ist ein zentraler und im Hinblick auf das Anklageprinzip
unersetzbarer Bestandteil der Funktionseinheit „Strafrechtspflege“. Ihre
Bedeutung ist durch die – breiten internationalen Tendenzen folgende –
Rechtsentwicklung der letzten Jahre gestiegen (selbständige Wahrnehmung der
Strafbefreiung wegen mangelnder Strafwürdigkeit der Tat gemäß § 42 StGB;
Verfolgungsverzicht nach § 6 JGG 1988; Modellprojekte „Außergerichtlicher Tatausgleich“;
Einführung der Diversion; Übertragung der Leitungsbefugnis im
Ermittlungsverfahren durch das gerade beschlossene Strafprozessreformgesetz).
Heute wird zahlenmäßig eine deutliche Mehrheit der Endentscheidungen im
Strafverfahren, nämlich insbesondere Verfahrenseinstellungen mangels
ausreichenden Tatverdachts bzw ausreichender Verurteilungswahrscheinlichkeit
einerseits sowie Diversionsentscheidungen im Bereich minderschwerer und
teilweise mittelschwerer Kriminalität andererseits, von der Staatsanwaltschaft
getroffen. In diesem Sinne werden im ersten Satz des Textvorschlags Bestand und
Funktion der Staatsanwaltschaften als Träger der öffentlichen Anklage
verfassungsrechtlich abgesichert. Dabei wird zwar kein ausdrücklicher Verweis
auf die Strafprozessordnung in den Verfassungstext aufgenommen, jedoch vom
bisherigen Stand der Strafprozessordnung und ihrer Weiterentwicklung auf
einfachgesetzlicher Ebene ausgegangen. Mit der Wendung „justizielle
Strafverfolgung“ – sie korrespondiert im Übrigen mit der neu vorgeschlagenen
Überschrift des Abschnitts B. des Dritten Hauptstücks des B-VG („Justiz“) –
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich beim neuen Abs 3 ausschließlich
um eine Bestands- und Funktionsgarantie zugunsten der Staatsanwaltschaften handelt,
von der weder die Strafverfolgungstätigkeit der Polizei und des Privatanklägers
noch die gerichtliche Strafverfolgungstätigkeit (Beweisaufnahme im
Vorverfahren, Rechtsschutz, Anklageprüfung, etc.) berührt werden. In diesem
Sinne ist aus dem neu angefügten Abs 3 im Zusammenhalt mit Art 90 Abs 2 B-VG,
wonach im Strafverfahren der Anklageprozess gilt, die Zulässigkeit, ja in
manchen Fällen die Notwendigkeit richterlichen Rechtsschutzes im Strafverfahren
abzuleiten.
Zu Satz 2: Das Dienst- und Organisationsrecht der Staatsanwaltschaften (im Staatsanwaltschaftsgesetz [StAG]) entspricht schon jetzt nicht dem einer Behörde der allgemeinen Verwaltung und weist insbesondere im Bereich des internen und externen Aufsichts- und Weisungsrechts markante Besonderheiten auf (vgl §§ 29 ff StAG). Der Absicherung einer unparteiischen, von sachfremden Einflüssen freien Amtsausübung der Staatsanwälte kommt – auch im Lichte der gesamteuropäischen Rechtsentwicklung[29] - besondere rechtsstaatliche Bedeutung zu.
Der Ausschuss will dieser Bedeutung – über eine Bestands- und Funktionsgarantie der Staatsanwaltschaft als solcher hinaus – Rechnung tragen, ohne möglichen künftigen Entwicklungen auf einfachgesetzlicher Ebene (etwa im Sinne einer Differenzierung oder einer verstärkten Transparenz der Ausübung des Weisungsrechts) vorzugreifen oder solche zu präjudizieren. Der zweite Satz des vorstehenden Textvorschlags stellt einen Versuch in diese Richtung dar.
Zu Punkt II) 4): Entfall der Mitkompetenz
der Landesregierungen bei Sprengeländerungen der Gerichte?
Textvorschlag für eine entsprechende Aufhebungsanordnung
§ 8 Abs 5 lit d) des Übergangsgesetzes aus 1920, StGBl 1920/451 idF BGBl 1925/368 [Wv] idF BGBl I 1999/194, wird aufgehoben.
Erläuterungen:
Wie bereits im Allgemeinen Teil des Ausschussberichts erwähnt, konnte im Ausschuss grundsätzlich Konsens darüber erzielt werden, die Bestimmung des § 8 Abs 5 lit d) ÜG 1920, wonach Verordnungen über Änderungen in den Sprengeln der Bezirksgerichte nur mit Zustimmung der jeweiligen Landesregierung erlassen werden dürfen, ersatzlos zu streichen. Als Argument für diesen Entfall wurde ins Treffen geführt, dass diese Bestimmung im Bereich der ansonsten bundesgesetzlich geregelten Gerichtsbarkeit einem „Fremdkörper“ gleiche und wohl auch nur historisch erklärbar sei. Diese Regelung sollte ja nach dem Einleitungssatz des § 8 Abs 5 ÜG 1920 auch nur solange gelten, bis die Organisation der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Ländern durch ein gemäß Art 120 B-VG zu erlassendes Bundesverfassungsgesetz und die Ausführungsgesetze hiezu geregelt ist; tatsächlich ist ein solches Bundesverfassungsgesetz bis heute nicht erlassen worden.
Zu Punkt III): Gerichtshöfe öffentlichen
Rechts – Verhältnis der Höchstgerichte zueinander
Erstentwurf Jabloner/Grabenwarter
für die Einführung eines „Subsidiarantrags“,
in einem (nach dem derzeitigen System) neuen Art 140 Abs 1a B-VG
In Art 140 wird folgender Abs 1a eingefügt:
„(1a) Der
Verfassungsgerichtshof erkennt ferner über Verfassungswidrigkeit von Gesetzen
nach Fällung einer rechtskräftigen Entscheidung durch ein in Abs 1 genanntes
Gericht, ausgenommen den Verfassungsgerichtshof; dies auf Antrag einer Person,
die Partei dieses Verfahrens war und die Anwendung eines verfassungswidrigen
Gesetzes behauptet. Für solche Anträge gilt Art 89 Abs 3 sinngemäß. Mit der
Aufhebung des Gesetzes oder dem Ausspruch seiner Verfassungswidrigkeit gilt das
gerichtliche Verfahren als wieder aufgenommen.“
[Sofern einem
solchen Vorschlag überhaupt näher getreten wird, könnte dem entsprechend auch
in Art 139 folgender neuer Abs 1a eingefügt werden:
„(1a) Der
Verfassungsgerichtshof erkennt ferner über Gesetzwidrigkeit von Verordnungen
nach Fällung einer rechtskräftigen Entscheidung durch ein in Art 89 Abs 2
genanntes Gericht, den Verwaltungsgerichtshof oder ein Verwaltungsgericht
erster Instanz; dies auf Antrag einer Person, die Partei dieses Verfahrens war
und die Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung behauptet. Art 89 Abs 3 gilt
sinngemäß. Mit der Aufhebung der Verordnung oder dem Ausspruch ihrer
Gesetzwidrigkeit gilt das gerichtliche Verfahren als wieder aufgenommen.“]
Erläuterungen
(vorläufig):
1. Dieser Entwurf setzt
die Umwandlung der Unabhängigen Verwaltungssenate in Landesverwaltungsgerichte
voraus. Im Hinblick darauf kann allgemein von den in Art 140 Abs 1 erster Satz
B-VG genannten „Gerichten“ gesprochen werden (bei der Verordnungsprüfung
ist die Aufzählung der betreffenden Stellen breiter). Ansonsten wird vom status
quo ausgegangen.
2. Für die legistische
Einordnung in die Art 139 und 140 B-VG wurde vorerst der Weg gewählt, neue
Absätze „1a“ einzurichten. Dies deshalb, weil die Absätze 1 der Art 139 f B-VG
schon lang sind und man die Textierung dieser Bestimmungen überhaupt überlegen
sollte.
3. Zu den „Gerichten“
gehört auch der VfGH. Wenn man davon geleitet ist, dass der VfGH Normbedenken
grundsätzlich aus Eigenem aufgreifen soll, muss eine entsprechende
Einschränkung gemacht werden. Der oben vorgeschlagene Textentwurf folgt dieser
Auffassung.
4. Soll der
Subsidiarantrag auf der Ebene der Verordnungsprüfung überhaupt eingeführt
werden? Ein verfassungspolitisches Bedürfnis danach wurde wohl noch nicht
artikuliert.
5. Es stellt sich die
Frage, ob der Subsidiarantrag nur dann zulässig sein soll, wenn der
Beschwerdeführer zuvor im Verfahren vor den antragsberechtigten Gerichten die
Normbedenken geltend gemacht und eine Antragstellung an den VfGH angeregt hat,
dieser Anregung aber nicht gefolgt wurde. Hier können zwei Denkschulen
vertreten werden: Man kann den Fall anvisieren, dass der Beschwerdeführer eben
erst nach der Entscheidung des Gerichts wahrnimmt, dass die
Verfassungswidrigkeit in der Norm liegen könnte. Dies hätte vor allem Bedeutung
für die Relation zwischen der Justiz und dem VfGH – hinsichtlich von
Verwaltungsakten (verwaltungsgerichtlichen Urteilen) steht ja Art 144 Abs 1
zweiter Fall B-VG zur Verfügung. Dies würde dafür sprechen, keine Einschränkung
zu setzen. Man kann aber auch die Ansicht vertreten, dass eine solche
Konstruktion ein gewisses Missbrauchspotential eröffnen könnte, was wiederum
für die Einschränkung spräche, an im gerichtlichen Verfahren bereits geltend
gemachte Bedenken anzuknüpfen. Der oben erstattete Textvorschlag folgt
vorläufig der ersten Denkschule.
6. Der Entwurf ist von
der Erwägung geleitet, dass ein Subsidiarantrag dann zulässig sein soll, wenn
ein in Art 140 Abs 1 erster Satz B-VG etc genanntes „Gericht“ befasst
war. Es ist also nicht vorgesehen, dass vor Stellung des Subsidiarantrags ein
Instanzenzug an den VwGH oder OGH ausgenützt oder gesetzlich eingerichtet
werden muss. Dies entspricht dem gegebenen System, in dem ja eine
Antragsberechtigung auch nachgeordneter Gerichte vorgesehen ist.
7. Zur Straffung des –
ja bereits bedenklich langen – Verfahrens erscheint es zweckmäßig, schon im
Verfassungstext festzulegen, dass mit der Aufhebung des Gesetzes (dem Ausspruch
seiner Verfassungswidrigkeit) das gerichtliche Verfahren wieder aufgenommen
ist. Das bedeutet aber auch, dass sich der Beschwerdeführer darüber im Klaren
sein muss, dass der Normaufhebung das fortgesetzte Verfahren folgt. Man könnte
darin auch eine Vorkehrung gegen einen Missbrauch des Subsidiarantrags sehen.
8. Für die Art 139a und
140a B-VG sind anscheinend keine besonderen Regelungen notwendig.
9. Im Entwurf des Art
139 Abs 1a B-VG ist die Antragsberechtigung nach § 24 Abs 11 UVP-Gesetz
2000 vorerst nicht berücksichtigt. (Es ist nicht klar, ob das eine „abstrakte“
oder eine „konkrete“ Normprüfung ist).
10. Es wird – der
diesbezüglichen Diskussion im Ausschuss entsprechend – davon Abstand genommen,
Bindungsfragen zu regeln.
12. Die Formulierung
sollte es ausschließen, dass auch Amtsparteien im Sinne des Art 131 Abs 1
Z 2 und 3 und Abs 2 B-VG vom Subsidiarantrag Gebrauch machen können (arg: „Person“).
Dies ist deshalb wichtig, weil die Grenze zwischen konkreter und abstrakter
Normprüfung nicht verwischt werden soll. Sonst könnte etwa ein Bundesminister
über die Anfechtung eines Bescheids der Landesregierung die
Verfassungsmäßigkeit des Bundesgesetzes bekämpfen, eine Möglichkeit die nach
Art 140 Abs 1 B-VG ansonsten nicht gegeben wäre.
13. Durch die Anordnung,
dass der Subsidiarantrag erst nach einer gerichtlichen Entscheidung zulässig
ist, wird es ausgeschlossen, dass der Beschwerdeführer (die Verfahrenspartei
des gerichtlichen Verfahrens) parallel zur gerichtlichen Anfechtung einer
generellen Norm einen Subsidiarantrag stellt. Es bleibt der nicht ausdrücklich
geregelte Fall, dass das Gericht einen entsprechenden Antrag gestellt hat, der
VfGH sein Verfahren durchgeführt hat und das Gericht dann zu seiner
Entscheidung findet. Für diesen Fall ist es immerhin vorstellbar, dass der
Beschwerdeführer (die Verfahrenspartei) nunmehr verfassungsrechtliche Bedenken
äußert, die noch nicht Gegenstand des verfassungsgerichtlichen Verfahrens war.
Man könnte diese Problematik entweder im Verfassungstext berücksichtigen – was
nicht recht zweckmäßig erscheint – oder auf der Ebene des VfGG lösen oder überhaupt
der Judikatur überlassen.
14. Im Verfassungstext
sollte auch zum Ausdruck kommen, dass die „Person“, die als
Beschwerdeführer vor dem VfGH auftritt, Verfahrenspartei des zugrunde liegenden
gerichtlichen Verfahrens gewesen ist (für den VwGH vgl aber oben Punkt 12.).
Dies erscheint auch zweckmäßig im Hinblick auf eine Abgrenzung zum
„benachbarten“ Individualantrag.
15. Im Gegensatz zu
einem früheren Formulierungsvorschlag (vgl Jabloner, Strukturfragen der
Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts, ÖJZ 1998, 161 ff) wird im vorliegenden
Entwurf die Wendung „in ihren Rechten“, die beim Individualantrag
nach Art 144 Abs
1 B-VG verwendet wird, nicht übernommen. Maßgebend dafür ist, dass der
Subsidiarantrag der gerichtlichen Antragstellung an den VfGH nachgebildet ist
und dort ja auch nicht darauf abgestellt wird, ob eine Verfahrenspartei „in
ihren Rechten“ verletzt ist. Auf der anderen Seite findet sich diese Formel im
strukturell ähnlichen Fall des Art 144 Abs 1 zweiter Fall B-VG. Daraus ließe
sich wiederum ein Gegenargument ableiten.
Zu Punkt IV): Verwaltungsgerichtsbarkeit
(in den Ländern)
Gemeinsamer Textvorschlag Grabenwarter/Jabloner
für die verfassungsrechtliche Verankerung
der Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz,
insbesondere für neue (nach dem derzeitigen System) Art 129 bis 136
B-VG
(aufgrund eines von Univ.-Prof. DDr. Grabenwarter überarbeiteten Entwurfs des BKA/VD)
Entwurf eines
Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:
Das Bundes-Verfassungsgesetz, zuletzt geändert durch das Bundesverfassungsgesetz BGBl I Nr XXX/2004, wird wie folgt geändert:
1. In Art 10 Abs 1 Z 6 wird nach dem Ausdruck „Verwaltungsgerichtsbarkeit“ der Ausdruck „, ausgenommen Angelegenheiten der Verwaltungsgerichte der Länder“ eingefügt.
2. In Art 11 Abs 1 wird folgende Z 8 angefügt:
„8. Verfahren der Verwaltungsgerichte.“
3. In Art 81a Abs 4 wird der letzte Satz aufgehoben.
4. Art 82 Abs 1 lautet:
„(1) Alle Gerichtsbarkeit geht, soweit bundesverfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, vom Bund aus.“
5. Art 89 lautet:
„Artikel 89. (1) Die Prüfung der Gültigkeit gehörig kundgemachter Verordnungen, Wiederverlautbarungen, Gesetze und Staatsverträge steht, soweit in diesem Artikel nicht anderes bestimmt ist, den Gerichten nicht zu.
(2) Hat ein Gericht gegen die Anwendung einer Verordnung aus dem Grund der Gesetzwidrigkeit Bedenken, so hat es den Antrag auf Aufhebung dieser Verordnung beim Verfassungsgerichtshof zu stellen. Hat ein Gericht gegen die Anwendung eines Gesetzes aus dem Grund der Verfassungswidrigkeit Bedenken, so hat es den Antrag auf Aufhebung dieses Gesetzes beim Verfassungsgerichtshof zu stellen.
(3) Ist die vom Gericht anzuwendende Rechtsvorschrift bereits außer Kraft getreten, so hat der Antrag des Gerichts an den Verfassungsgerichtshof die Feststellung zu begehren, dass die Rechtsvorschrift gesetzwidrig oder verfassungswidrig war.
(4) Abs 2 erster Satz und Abs 3 gelten für Wiederverlautbarungen, Abs 2 und Abs 3 nach Maßgabe des Art 140a für Staatsverträge sinngemäß.
(5) Welche Wirkungen der Antrag des Gerichts für das bei ihm anhängige Verfahren hat, wird durch Bundesgesetz geregelt.“
6. In Art 118 Abs 4 entfallen die Wendungen „– vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 119a Absatz 5 –“ und „außerhalb der Gemeinde“.
7. Art 119a Abs 5 entfällt.
8. In Art 119a Abs 9 wird der Ausdruck „vor
dem Verwaltungsgerichtshof (Artikel 131 und 132)“ durch den Ausdruck „vor
den Verwaltungsgerichten (Artikel 131 und 132), vor dem Verwaltungsgerichtshof
(Artikel 133)“ ersetzt.
9. An die Stelle der Absatzbezeichnungen „(6)“ bis „(10)“ in Art 119a treten die
Absatzbezeichnungen „(5)“ bis „(9)“.
10. Vor Art 129 wird die Überschrift „A.
Verwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshof“ eingefügt.
11. Art 129 lautet:
„Artikel 129. (1) Zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der gesamten öffentlichen Verwaltung sind die Verwaltungsgerichte und der Verwaltungsgerichtshof berufen. Der Verwaltungsgerichtshof hat seinen Sitz in Wien.
(2) In jedem Land ist ein Verwaltungsgericht des Landes einzurichten. Darüber hinaus können die Länder für die Angelegenheiten des Bauwesens und die Angelegenheiten des Abgabenwesens sowie für sonstige Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde besondere Verwaltungsgerichte einrichten.
(3) Zur Entscheidung in verfassungsgesetzlich zu bestimmenden Angelegenheiten des Art 10 Abs 1 B-VG sind Verwaltungsgerichte des Bundes erster Instanz einzurichten.“
12. Die Überschriften vor Art 129a, vor Art 129c und vor Art 130
sowie die Art 129a bis 129c werden aufgehoben.
13. Art 130 lautet:
„Artikel 130. (1) Die Verwaltungsgerichte erkennen über Beschwerden
1. gegen Bescheide der Verwaltungsbehörden wegen Rechtswidrigkeit;
2. gegen die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt durch Verwaltungsbehörden wegen Rechtswidrigkeit;
3. wegen Verletzung der
Entscheidungspflicht der Verwaltungsbehörden;
4. in sonstigen Angelegenheiten, die den Verwaltungsgerichten durch die die einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden Bundes- oder Landesgesetze zugewiesen werden. Den Verwaltungsgerichten der Länder dürfen Angelegenheiten durch Bundesgesetz nur mit Zustimmung der Länder zugewiesen werden.
(2) Rechtswidrigkeit liegt nicht vor, soweit die Gesetzgebung von einer bindenden Regelung des Verhaltens der Verwaltungsbehörde absieht und die Bestimmung dieses Verhaltens der Behörde selbst überlässt, die Behörde aber von diesem freien Ermessen im Sinne des Gesetzes Gebrauch gemacht hat.
(3) In den Angelegenheiten des Abs 1 Z 1 – ausgenommen in Angelegenheiten des Art 131 Abs 1 Z 1 – hat das Verwaltungsgericht in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Rechtsfrage geklärt ist und der Sachverhalt entweder feststeht oder vom Verwaltungsgericht – insbesondere im Rahmen einer mündlichen Verhandlung – festgestellt werden kann, soweit anzunehmen ist, dass dies im Interesse der Beschleunigung der Erledigung oder einer erheblichen Kosteneinsparung gelegen ist. In den Angelegenheiten des Art 131 Abs 1 Z 1 hat das Verwaltungsgericht jedenfalls in der Sache selbst zu entscheiden.“
14. Art 131 lautet:
„Artikel 131. (1) Die Verwaltungsgerichte der Länder erkennen nach Maßgabe des Art 130:
1. in allen Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen;
2. über alle Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt durch Verwaltungsbehörden;
3. in allen übrigen Angelegenheiten, ausgenommen jenen, in denen nach Abs 2 die Verwaltungsgerichte des Bundes zuständig sind.
(2) Die Verwaltungsgerichte des Bundes erkennen nach Maßgabe des Art 130 und des Abs 1 Z 3:
1. in Angelegenheiten des Art 10 Abs 1 Z 3 und 7 mit Ausnahme der Personenstandsangelegenheiten sowie in Angelegenheiten des Pressewesens und des Patentwesens;
1.2.in
Angelegenheiten der Abgaben- und Finanzstrafsachen des Bundes;
3. in Angelegenheiten, die in erster Instanz in die Zuständigkeit der Bundesregierung, eines Bundesministers oder einer anderen Bundesbehörde mit örtlicher Zuständigkeit für das gesamte Bundesgebiet fallen und die Akte der Vollziehung betreffen, die für das gesamte Bundesgebiet oder für mehrere Länder wirksam werden;
4. über Beschwerden gegen einvernehmliche Bescheide der zuständigen Landesbehörden und Bescheide eines Bundesministers nach Art 15 Abs 7.
(3) Durch Landesverfassungsgesetz kann für einzelne Angelegenheiten des Abs 2 Z 1 das Verwaltungsgericht des Landes für den Bereich eines Landes zuständig gemacht werden. Ein solches Landesverfassungsgesetz bedarf der Zustimmung der Bundesregierung (Art 97 Abs 2).“
15. Art 132 lautet:
„Artikel 132. (1) Gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde kann wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben:
1. wer durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet nach Erschöpfung des Instanzenzugs;
2. der zuständige Bundesminister in den Angelegenheiten der Art 11, 12, 14 Abs 2 und 3 und 14a Abs 3 und 4 sowie in jenen Angelegenheiten, in denen dem Bescheid eines Landes- oder Bezirksschulrats ein kollegialer Beschluss zugrunde liegt, soweit die Parteien den Beschluss nicht mehr anfechten können;
3. die Landesregierung gegen Bescheide des zuständigen Bundesministers in den Angelegenheiten des Art 15 Abs 5 erster Satz und des Art 15 Abs 7;
4. in weiteren Fällen nach Maßgabe der die einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden Bundes- oder Landesgesetze wer unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen dazu berechtigt ist.
(2) Gegen die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt durch Verwaltungsbehörden wegen Rechtswidrigkeit kann Beschwerde erheben, wer behauptet, durch die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt in seinen Rechten verletzt zu sein.
(3) Wegen Verletzung der Entscheidungspflicht kann Beschwerde erheben, wer als Partei im Verwaltungsverfahren zur Geltendmachung der Entscheidungspflicht berechtigt war. Die Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in Verwaltungsstrafsachen kann gesetzlich ausgeschlossen werden.“
16. Art 133 lautet:
„Artikel 133. (1) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt kassatorisch über:
1. Revisionen gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte nach Maßgabe des
Abs 3 wegen Rechtswidrigkeit;
2. Beschwerden gegen die Nichtzulassung der Revision wegen Rechtswidrigkeit;
3. Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungsgerichten oder zwischen einem Verwaltungsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof.
(2) Von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs sind jene Angelegenheiten ausgeschlossen, die zur Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofs gehören.
(3) Gegen die Entscheidung eines Verwaltungsgerichts kann von den Parteien des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens wegen Rechtswidrigkeit Revision eingelegt werden, wenn das Verwaltungsgericht oder nach Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Verwaltungsgerichtshof die Revision zugelassen hat. Mit der Beschwerde ist zugleich die Revision auszuführen. Die zuständige Landesregierung in Angelegenheiten der Landesverwaltung und der zuständige Bundesminister in Angelegenheiten der Bundesverwaltung können unter diesen Bedingungen auch dann Revision einlegen, wenn sie nicht Parteien sind.
(4) Die Revision ist zuzulassen, wenn
1. die angefochtene Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil die Entscheidung von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs nicht einheitlich beantwortet wird, oder wenn
2. im Fall einer Verwaltungsstrafsache die Begehung der Verwaltungsübertretung nicht nur mit einer geringen Geldstrafe bedroht ist.
(5) Der Verwaltungsgerichtshof kann die Behandlung von Beschwerden und von Revisionen gemäß Abs 1 Z 1 ablehnen, wenn keine der Voraussetzungen des Abs 4 Z 1 oder 2 gegeben ist.“
17. Art 134 lautet:
„Artikel 134. (1) Die Verwaltungsgerichte und der Verwaltungsgerichtshof bestehen aus je einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und der erforderlichen Zahl von sonstigen Mitgliedern (Senatspräsidenten und Richtern).
(2) Den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung. Die Bundesregierung erstattet ihre Vorschläge, soweit es sich nicht um die Stelle des Präsidenten oder Vizepräsidenten handelt, auf Grund von Dreiervorschlägen der Vollversammlung des Verwaltungsgerichtshofs. Die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs müssen die rechtswissenschaftlichen Studien vollendet und bereits durch mindestens zehn Jahre eine Berufsstellung bekleidet haben, für die die Vollendung dieser Studien erforderlich ist. Wenigstens der dritte Teil der Mitglieder muss die Befähigung zum Richteramt haben, wenigstens der vierte Teil soll aus Berufsstellungen in den Ländern, womöglich aus dem Verwaltungsdienst der Länder entnommen werden.
(3) Den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die übrigen Mitglieder der Verwaltungsgerichte des Bundes ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung. Die Bundesregierung erstattet ihre Vorschläge, soweit es sich nicht um die Stelle des Präsidenten oder Vizepräsidenten handelt, auf Grund von Dreiervorschlägen des jeweiligen Verwaltungsgerichts des Bundes. Die Mitglieder der Verwaltungsgerichte des Bundes müssen die rechtswissenschaftlichen Studien vollendet und bereits durch mindestens fünf Jahre eine Berufsstellung bekleidet haben, für die die Vollendung dieser Studien erforderlich ist. Wenigstens der vierte [fünfte?] Teil der Mitglieder soll aus Berufsstellungen der Länder, womöglich aus dem Verwaltungsdienst der Länder entnommen werden. Wenigstens der vierte [fünfte?] Teil der Mitglieder soll womöglich aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit entnommen werden.
(4) Den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsgerichts eines Landes ernennt die Landesregierung. Die Ernennung erfolgt, soweit es sich nicht um die Stelle des Präsidenten oder Vizepräsidenten handelt, auf Grund von Dreiervorschlägen des Verwaltungsgerichts des Landes. Die Mitglieder der Verwaltungsgerichte müssen die rechtswissenschaftlichen Studien vollendet und bereits durch mindestens fünf Jahre eine Berufsstellung bekleidet haben, für die die Vollendung dieser Studien erforderlich ist. Wenigstens der vierte [fünfte?] Teil der Mitglieder soll aus Berufsstellungen im Bund, womöglich aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit entnommen werden.
(5) Den Verwaltungsgerichten und dem Verwaltungsgerichtshof können Mitglieder der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines allgemeinen Vertretungskörpers nicht angehören; für Mitglieder der allgemeinen Vertretungskörper, die auf eine bestimmte Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode gewählt wurden, dauert die Unvereinbarkeit auch bei vorzeitigem Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode fort.
(6) Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten eines Verwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichtshofs kann nicht bestellt werden, wer eine der in Abs 5 bezeichneten Funktionen in den letzten vier Jahren bekleidet hat.
(7) Alle Mitglieder der Verwaltungsgerichte und des Verwaltungsgerichtshofs sind berufsmäßig angestellte Richter. Die Bestimmungen des Artikels 87 Abs 1 und 2 und des Artikels 88 Abs 2 finden auf sie Anwendung. Am 31. Dezember des Jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, treten die Mitglieder der Verwaltungsgerichte und des Verwaltungsgerichtshofs kraft Gesetzes in den dauernden Ruhestand.“
18. Art 135 lautet:
„Artikel 135. (1) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt in Senaten. Die Verwaltungsgerichte erkennen durch Einzelmitglieder, soweit nicht das auf Grundlage des Art 136 Abs 1 oder Abs 2 ergangene Gesetz die Entscheidung in Senaten vorsieht. Die Senate sind von der Vollversammlung aus den Mitgliedern des Gerichts zu bilden.
(2) Die Geschäfte des Verwaltungsgerichtshofs sind durch die Vollversammlung, jene der Verwaltungsgerichte nach Maßgabe gesetzlicher Regelung auch durch ein anderes von deren Vollversammlung gewähltes Organ auf die einzelnen Senate oder auf die einzelnen Mitglieder für die durch Gesetz bestimmte Zeit im voraus zu verteilen.
(3) Eine nach dieser Einteilung einem Mitglied zufallende Sache darf
diesem nur durch das nach Abs 2 zuständige Organ und nur im Falle seiner
Verhinderung oder dann abgenommen werden, wenn es wegen des Umfangs seiner
Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer angemessenen Frist gehindert ist.“
19. Art 136 lautet:
„Artikel 136. (1) Die näheren Bestimmungen über Einrichtung und Aufgabenkreis der Verwaltungsgerichte des Bundes und des Verwaltungsgerichtshofs werden durch ein besonderes Bundesgesetz geregelt.
(2) Die näheren Bestimmungen über Einrichtung und Aufgabenkreis der Verwaltungsgerichte der Länder sowie das Dienstrecht ihrer Mitglieder werden durch Landesgesetz geregelt.
[hinsichtlich Dienstrecht: eventuell Homogenitätsprinzip oder einheitliches Dienstrecht ?]
(3) Das Verfahren der Verwaltungsgerichte und des Verwaltungsgerichtshofs wird durch ein besonderes Bundesgesetz geregelt.
(4) Die Vollversammlungen der Verwaltungsgerichte und des Verwaltungsgerichtshofs beschließen auf Grund der nach den vorstehenden Absätzen erlassenen Gesetze Geschäftsordnungen, in denen Näheres über den Geschäftsgang und das Verfahren geregelt wird.“
20. Die Überschrift vor Art 137 lautet: „B.
Verfassungsgerichtshof“.
21. Art 138 Abs 1 lit b lautet:
„b) zwischen den Verwaltungsgerichten oder zwischen dem Verwaltungsgerichtshof einerseits und allen anderen Gerichten andererseits, insbesondere auch zwischen diesen Gerichten und dem Verfassungsgerichtshof selbst, sowie zwischen den ordentlichen Gerichten und anderen Gerichten;“
22. In Art 139 Abs 1 erster Satz entfallen die Worte „oder eines unabhängigen Verwaltungssenates“.
23. Art 140 Abs 1 erster Satz lautet:
„Der Verfassungsgerichtshof erkennt über die Verfassungswidrigkeit eines Bundes- oder Landesgesetzes auf Antrag eines Gerichts, sofern aber der Verfassungsgerichtshof ein solches Gesetz in einer anhängigen Rechtssache anzuwenden hätte, von Amts wegen.“
[An dieser Stelle könnte – etwa in einem eigenen Art 140 Abs 1a B-VG – die Bestimmung über den Subsidiarantrag „geparkt“ werden, bis man sich über die endgültige legistische Einordnung im Klaren ist; vgl dazu näher den derzeit im Besonderen Teil unter Punkt III) abgedruckten Erstentwurf von Präsident Univ.-Prof. Dr. Jabloner und Univ.-Prof. DDr. Grabenwarter zum „Subsidiarantrag“.]
24. Art 144 lautet:
„Artikel 144. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Beschwerden gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, soweit der Beschwerdeführer durch die Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung, einer gesetzwidrig wiederverlautbarten Rechtsvorschrift, eines verfassungswidrigen Gesetzes oder eines rechtswidrigen Staatsvertrags in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet.
(2) Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde bis zur Verhandlung durch Beschluss ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder von der Entscheidung die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht zu erwarten ist. Die Ablehnung der Beschwerde ist unzulässig, wenn es sich um einen Fall handelt, der nach Art 133 Abs 2 von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs ausgeschlossen ist.
(3) Findet der Verfassungsgerichtshof, dass durch die Entscheidung eines Verwaltungsgerichts ein Recht im Sinne des Abs 1 nicht verletzt wurde, so hat der Beschwerdeführer das Recht, innerhalb der hiefür gesetzlich bestimmten Frist beim Verwaltungsgerichtshof Revision oder im Fall der Nichtzulassung der Revision Nichtzulassungsbeschwerde zu erheben. Dies gilt sinngemäß bei Beschlüssen nach Abs 2.“
25. Art 151 wird folgender Abs 28 angefügt:
[ein von der Ausschussbetreuung erarbeiteter „Rohentwurf“
ist hier noch nicht eingearbeitet]
Erläuterungen:
Zu Z 1 (Art 10 Abs 1 Z 6) und Z 2 (Art 11 Abs 1 Z 8)
Die Angelegenheiten der Verwaltungsgerichte der Länder sind im Hinblick auf Art 134 Abs 5 und Art 135 Abs 3 B-VG vom Kompetenztatbestand „Verwaltungsgerichtsbarkeit“ auszunehmen. Die Organisation der Verwaltungsgerichte der Länder ist in Gesetzgebung und Vollziehung Landessache. Sie umfasst neben der Regelung der Einrichtung auch die Festlegung des Aufgabenkreises der Verwaltungsgerichte der Länder im Rahmen der Bundesverfassung (vgl Art 136 Abs 3 B-VG). Dass das Dienstrecht der Richter der Verwaltungsgerichte der Länder in Gesetzgebung und Vollziehung Landessache ist, ergibt sich aus Art 21 B-VG. Das Verfahrensrecht wird vom Bundesgesetzgeber geregelt, die Vollziehung (durch Verwaltungsgerichte der Länder als Landesorgane) fällt in den Vollzugsbereich der Länder. Die Organisation der Verwaltungsgerichte des Bundes sowie das Dienstrecht seiner Richter ist in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. Für den Verwaltungsgerichtshof tritt keine Änderung ein.
Die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte und des Verwaltungsgerichtshofs sind grundsätzlich im Sechsten Hauptstück abschließend geregelt. Die allgemeine Kompetenzverteilung im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit wird in zwei Fällen durchbrochen. Nach Art 130 Abs 1 Z 4 B-VG kann den Verwaltungsgerichten eine Zuständigkeit zur Entscheidung über Beschwerden in „sonstigen Angelegenheiten“ durch den Materiengesetzgeber zugewiesen werden. Gemäß Art 131 Abs 3 B-VG kann das Verwaltungsgericht des Landes durch Landesverfassungsgesetz mit Zustimmung der Bundesregierung in bestimmten Angelegenheiten aus der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts des Bundes erster Instanz zuständig gemacht werden.
Zu Z 3 (Art 81a Abs 4)
Wie bereits im Allgemeinen Teil (unter Punkt IV) 1) k)) näher ausgeführt, ist von dem in Art 81a Abs 4 letzter Satz B-VG verankerten Recht der Schulbehörde, gegen eine an sie gerichtete Weisung Beschwerde beim VwGH zu erheben, in den letzten Jahrzehnten – soweit überblickbar – nie Gebrauch gemacht worden. Der dem entsprechend erstattete Vorschlag, diese Bestimmung ersatzlos aufzuheben, fand in der Arbeitsgruppe einhellige Zustimmung.
Zu Z 4 (Art 82 Abs 1)
Die Neufassung dieser Bestimmung trägt der Einführung von Verwaltungsgerichten der Länder Rechnung.
Zu Z 5 (Art 89)
Auch den ordentlichen Gerichten erster Instanz (siehe Allgemeiner Teil, Punkt III) 1) vorletzter Absatz) und den Verwaltungsgerichten soll die Befugnis eingeräumt werden, rechtswidrige generelle Rechtsvorschriften beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Der Begriff des „Gerichts“ umfasst alle ordentlichen Gerichte sowie die Verwaltungsgerichte und den Verwaltungsgerichtshof. Diese Befugnis soll auch die Anfechtung von Wiederverlautbarungen erfassen. Aus dem geltenden Art 135 Abs 4 B-VG musste bisher der Schluss gezogen werden, dass Art 89 B-VG seit dem Inkrafttreten der B-VG-Novelle 1975 auf den Verwaltungsgerichtshof nur im Wege der Verweisung Anwendung findet. Dies entspricht nicht dem historischen Verständnis der Bundesverfassung, welches davon ausging, dass Art 89 des Bundes-Verfassungsgesetzes 1920 für alle Gerichte mit Ausnahme des Verfassungsgerichtshofs gilt (vgl Kelsen/Froehlich/Merkl, Bundesverfassung 1920 [1922], 181 ff). Anstatt eine weitere Verweisungsbestimmung für die Verwaltungsgerichte zu schaffen, soll Art 89 B-VG zur Gänze neu gefasst werden; dieser gilt künftig auch für die Verwaltungsgerichte und den Verwaltungsgerichtshof.
Zu Z 6 (Art 118 Abs 4), Z 7 (Art 119a Abs 5), Z 8
(Art 119a Abs 9) und Z 9 (Art 119a)
Der Entfall des Ausdrucks „außerhalb der Gemeinde“ in Art 118 Abs 4 B-VG (Z 6) bringt zum Ausdruck, dass hinkünftig auch im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde kein verwaltungsbehördlicher Instanzenzug mehr gegeben ist, sondern jeder Bescheid einer Gemeindebehörde direkt beim Verwaltungsgericht bzw in Ausnahmefällen beim Verwaltungsgerichtshof angefochten werden kann. Die Stellung des Gemeinderats als oberstes Organ im eigenen Wirkungsbereich wird dadurch nicht berührt.
Der Entfall der Vorstellung (Z 7) ist im Zusammenhang mit der Neuregelung der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu sehen. An die Stelle der Vorstellung tritt die Anfechtung des Bescheids eines Gemeindeorgans beim zuständigen Verwaltungsgericht.
In der Z 8 wird eine Anpassung an geänderte Zuständigkeiten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit vorgenommen.
Z 9 enthält die durch den Entfall der Vorstellung bedingten Änderungen der Absatzbezeichnungen.
Zu Z 10 und Z 11 (Überschrift vor Art 129, Art 129)
Art 129 B-VG zählt in Anlehnung an die bisherige Regelung jene Gerichte auf, die zur Verwaltungsgerichtsbarkeit gehören. Neben den Verwaltungsgerichten der Länder kann ein Verwaltungsgericht oder können mehrere Verwaltungsgerichte des Bundes eingerichtet werden. Dem Bundesgesetzgeber steht es also ausdrücklich frei, alle verfassungsgesetzlich zu bestimmenden Angelegenheiten des Art 10 Abs 1 B-VG gemäß Art 129 Abs 3 einem einzigen Verwaltungsgericht des Bundes erster Instanz zu übertragen. Der Sitz des Gerichts wird nur für den Verwaltungsgerichtshof im Einklang mit Art 5 B-VG verfassungsrechtlich festgelegt. Das bedeutet für die Verwaltungsgerichte des Bundes, dass sowohl eine dezentrale Sitzfestlegung als auch ein Verwaltungsgericht in Wien mit Außenstellen in den Ländern möglich ist. Durch den Begriff „Verwaltungsgerichte“ hat der Bund den erforderlichen Spielraum, besondere Verwaltungsgerichte etwa in Abgabensachen oder für Fälle, in denen bisher weisungsfreie Bundesbehörden tätig waren, einzurichten.
Abs 2 trägt dem Anliegen der Länder Rechnung, auf Sondersituationen, wie sie etwa historisch verfestigt in Wien bestehen, durch die Einrichtung besonderer Verwaltungsgerichte zu reagieren. Der Landesgesetzgeber wird ermächtigt, für bestimmte Angelegenheiten ein oder mehrere besondere Verwaltungsgerichte neben dem Verwaltungsgericht des Landes mit allgemeiner Zuständigkeit einzurichten. Es steht dem Landesgesetzgeber aber frei, diese Angelegenheiten in die Zuständigkeit des allgemein zuständigen Verwaltungsgerichts des Landes zu verweisen.
In terminologischer Hinsicht ist zur Überschrift zum Abschnitt A. und zu Art 129 B-VG zu bemerken, dass der Begriff des „Verwaltungsgerichts“ nur die Verwaltungsgerichte erster Instanz umfasst, wiewohl auch der Verwaltungsgerichtshof ein Verwaltungsgericht im funktionellen Sinn ist.
Zu Z 12 (Aufhebung der Überschriften vor Art 129a,
vor Art 129c und vor Art 130 sowie der Art 129a bis Art 129c)
Mit der Einrichtung der Verwaltungsgerichte werden die Unabhängigen Verwaltungssenate abgeschafft. Eigene Übergangsbestimmungen sollen ein klagloses Übergehen der Zuständigkeit auf die Verwaltungsgerichte sicherstellen (siehe Z 25 zum neuen Abs 28 des Art 151 B-VG).
Zu Z 13 (Art 130)
Abs 1 enthält eine taxative Aufzählung jener Beschwerden, über die zu entscheiden nunmehr die Verwaltungsgerichte zuständig sind; insoweit treten die Verwaltungsgerichte an die Stelle der bisherigen Berufungsbehörden, insbesondere der Unabhängigen Verwaltungssenate. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage beschränkt sich die Aufzählung auf die Beschwerdetatbestände, während die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Beschwerdeerhebung gesondert für jede Beschwerdeart in Art 132 B-VG geregelt sind. Gegenüber der bisherigen Zuständigkeit der Unabhängigen Verwaltungssenate enthält vor allem die Z 1 eine wesentliche Erweiterung, weil nunmehr gegen alle Bescheide der Verwaltungsbehörden nach Maßgabe des Art 130 Abs 4 und 132 Abs 1 B-VG Beschwerde erhoben werden kann. Der Tatbestand des Abs 1 Z 4 ist dennoch erforderlich, um in verfassungskonformer Weise Rechtsmittel an die Unabhängigen Verwaltungssenate, die sich weder gegen Bescheide noch gegen die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt richten, als Beschwerden an die Verwaltungsgerichte beibehalten zu können (vgl etwa § 88 Abs 2 SPG; Zuständigkeiten im Vergaberecht der Länder ‑ vgl VfGH 26.6.1997, G 270/96 ua).
Abs 2 entspricht der Regelung des geltenden Art 130 Abs 2 B-VG. Sie bezieht sich zwar nach dem systematischen Zusammenhang nur auf die Verwaltungsgerichte im engeren Sinn. In Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen gilt die Beschränkung des Art 130 Abs 2 B-VG im Hinblick auf die unbeschränkte reformatorische Entscheidungsbefugnis der Verwaltungsgerichte (Abs 3) nicht. Diese sind daher selbst zur Ermessensausübung insbesondere bei der Festsetzung der Strafhöhe befugt.
Abs 3 regelt Grundzüge der Entscheidungsbefugnis der Verwaltungsgerichte in Verfahren über Bescheidbeschwerden. Die Neuregelung sieht – schon aus praktischen Erwägungen und um überflüssige Verfahrensverzögerungen zu vermeiden – grundsätzlich eine reformatorische Entscheidungsbefugnis der Verwaltungsgerichte vor, wobei diese jedoch – nach Vorbild des geltenden § 66 Abs 2 AVG – auch die Möglichkeit zur kassatorischen Entscheidung haben sollten. Einzelheiten der Entscheidungsbefugnis der Verwaltungsgerichte, wie die Kontrollbefugnis in Rechts- und Tatsachenfragen, Fragen der Beweiswürdigung oder die Bindungswirkung der Entscheidungen, sind im Verfahrensgesetz für die Verwaltungsgerichte zu regeln (Z 19). Angesichts der Anforderungen des Art 6 EMRK wird eine volle Kognitionsbefugnis der Verwaltungsgerichte in Rechts- und in Sachverhaltsfragen vorzusehen sein. Für die Verfahren über Maßnahmebeschwerden und Säumnisbeschwerden erscheint eine verfassungsrechtliche Regelung der Entscheidungsbefugnis entbehrlich, da sie durch den Verfahrensgegenstand weitgehend vorgegeben ist. Für Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen gilt analog zur bisherigen Rechtslage für die Unabhängigen Verwaltungssenate abweichend, dass jedenfalls eine reformatorische Entscheidungsbefugnis besteht. Die Regelung der Entscheidungsbefugnis in Verfahren nach Abs 1 Z 4 obliegt dem einfachen Gesetzgeber, da sie auch in diesen Fällen vom Gegenstand des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens abhängt.
Zu Z 14 (Art 131)
In Art 131 B-VG werden die Zuständigkeiten der Verwaltungsgerichte nach Materien umschrieben. Die Zuständigkeitsverteilung erfolgt unter folgenden Gesichtspunkten:
Gemäß Abs 1 ist das Verwaltungsgericht des Landes grundsätzlich allgemein zuständiges Verwaltungsgericht erster Instanz. Es ist jedenfalls im Umfang der bisherigen Kompetenzen der Unabhängigen Verwaltungssenate in allen Verfahren betreffend Verwaltungsübertretungen sowie zur Entscheidung über alle Beschwerden gegen Akte unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt zuständig. Im Übrigen sind die Verwaltungsgerichte der Länder zuständig, soweit Angelegenheiten nicht bundesverfassungsgesetzlich den Verwaltungsgerichten des Bundes erster Instanz zugewiesen sind.
Mit der Einführung eigener Verwaltungsgerichte des Bundes erster Instanz in Abs 2 wird ein Vorschlag auf der Basis des so genannten „9 + 1-Modells“ erstattet, wie es bereits dem Grunde nach im Initiativantrag Nr. 306/A, XIX. GP NR, vorgesehen war und durch die B-VG-Novelle BGBl I 1997/87 auf der Ebene der Unabhängigen Verwaltungssenate verwirklicht wurde. Abs 2 weist diesem Verwaltungsgericht – vorerst – im Wesentlichen die Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung sowie die Angelegenheiten des Presse- und des Patentwesens zu. Mit dieser Kompetenzzuweisung wird der mit der Einführung des Unabhängigen Bundesasylsenats im Jahr 1997 eingeschlagene Weg fortgesetzt. [Die genaue Kompetenzumschreibung hängt vom Ergebnis der Beratungen des Ausschusses 5 ab.]
Gleich den Unabhängigen Verwaltungssenaten sollen auch der Unabhängige Finanzsenat und dessen Verfahren demselben rechtsstaatlichen Standard angepasst werden. Sie sollen jedoch nicht in die allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit eingegliedert werden (müssen), sondern durch ein besonderes Verwaltungsgericht (mit Außenstellen, entsprechend der Organisation des UFS) oder mehrere solcher Verwaltungsgerichte selbständig organisiert werden (können). Die Formulierung „Verwaltungsgerichte“ belässt dem einfachen Bundesgesetzgeber den erforderlichen Spielraum. Allenfalls wird man in den Übergangsbestimmungen darauf Bedacht zu nehmen haben, dass die Reform der Abgabenbehörden des Bundes erst kürzere Zeit zurückliegt und daher ein längerer Übergangszeitraum angemessen ist.
Die Z 3 und Z 4 des Abs 2 begründen eine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts des Bundes erster Instanz in Angelegenheiten, in denen die Begründung der örtlichen Zuständigkeit eines Verwaltungsgerichts eines Landes auf Schwierigkeiten stößt. Um zu verhindern, dass im Fall der Z 2 ein bestimmtes Verwaltungsgericht eines Landes (zB das Gericht jenes Landes, in dem die belangte Behörde ihren Sitz hat) zur Entscheidung über alle Akte berufen sein könnte, „die für das gesamte Bundesgebiet oder für mehrere Länder wirksam werden“, soll insoweit das Verwaltungsgericht des Bundes erster Instanz zuständig sein. Die zur Abgrenzung gewählte Formulierung ist einer entsprechenden Wendung im Art 15 Abs 7 B-VG nachgebildet. Von ähnlichen Überlegungen mit Bezug auf einzelne Länder ist die Z 3 getragen.
Die Abgrenzung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte im Bereich des Finanzstrafrechts folgt anderen Linien als die Abgrenzung der entsprechenden Zuständigkeiten der Unabhängigen Verwaltungssenate. Die „Finanzstrafsachen des Bundes“ umfassen – anders als der entsprechende Begriff im bisherigen Art 129a Abs 1 Z 1 und Z 2 B-VG – nur die Vollziehung finanzstrafrechtlicher Vorschriften des Bundes, nicht aber die Vollziehung landesgesetzlichen Finanzstrafrechts durch Finanzstrafbehörden des Bundes als Mitwirkung nach Art 97 Abs 2 B-VG.
Zu Z 15 (Art 132)
Art 132 B-VG enthält bestimmte grundlegende Voraussetzungen der Beschwerdelegitimation.
Abs 1 regelt die Beschwerdelegitimation für Bescheidbeschwerden. Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem Inhalt des geltenden Art 131 Abs 1 und 2 B-VG. [Hinsichtlich der Z 2 wird auf die Ergebnisse der Ausschüsse 5 und 6 Bedacht zu nehmen sein.] Abweichend von der bisher herrschenden Rechtslage wird ein Beschwerderecht einer betroffenen Landesregierung auch für den Fall des Art 15 Abs 7 B-VG verfassungsrechtlich verankert.
Die Regelung des Abs 2 über die Beschwerdelegitimation bei Maßnahmebeschwerden entspricht dem geltenden Art 129a Abs 1 Z 2 B-VG.
Abs 3 normiert die Legitimation zur Erhebung einer Säumnisbeschwerde. Gegenüber dem geltenden Art 132 B-VG wurde die Regelung vereinfacht. Sein erster Satz entspricht dem bisher geltenden Recht. Der Wortlaut des zweiten Satzes des geltenden Art 132 B-VG hat in der Rechtsprechung zu erheblichen Unklarheiten und Divergenzen geführt (zum Begriff „Finanzstrafsachen“ vgl VwGH 22.3.1996, Zl 95/17/0450, einerseits und VwGH 27.3.1996, Zl 96/13/0005, andererseits; zum Umfang des Säumnisschutzes in „Verwaltungsstrafsachen“ vgl VwSlgNF 11682 A/1985 und VfSlg 13987/1994). Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird davon abgesehen, die Berechtigung zur Erhebung der Säumnisbeschwerde im B-VG abschließend zu regeln.
Zu Z 16 (Art 133)
Nach Abs 1 soll der Verwaltungsgerichtshof – der vorgeschlagenen Neukonzeption der Verwaltungsgerichtsbarkeit entsprechend – zwar grundsätzlich als zweite gerichtliche Instanz in allen Angelegenheiten zuständig sein, die von den Verwaltungsgerichten entschieden werden. Er soll allerdings nur mehr als Revisionsgericht nach Zulassung der Revision durch das Verwaltungsgericht tätig werden.
Kennzeichen eines Revisionsgerichts ist im allgemeinen die beschränkte Kognitionsbefugnis und eine Beschränkung der Zulässigkeit der Revision. Dabei sollte letztlich immer der VwGH selbst über die Zulässigkeit der Revision entscheiden können: Wenn also die Revision vom Verwaltungsgericht erster Instanz nicht zugelassen wurde und dagegen Beschwerde geführt wird, hat der VwGH nach dem neu eingefügten Abs 5 über diese Beschwerde zu entscheiden (er kann ihr stattgeben oder nicht). Wenn das Verwaltungsgericht erster Instanz hingegen die Revision zugelassen hat, so wird der VwGH – ebenfalls im neu eingefügten Abs 5 – ermächtigt, die Behandlung der Revision gemäß Abs 1 abzulehnen, wenn keine der Voraussetzungen des Abs 4 Z 1 oder 2 gegeben ist. Diese Konstruktion entspricht der bewährten Regelung der ZPO, die in § 508a Abs 1 ausdrücklich vorsieht, dass bei der Prüfung der Zulässigkeit der Revision das Revisionsgericht (OGH) an den Ausspruch des Berufungsgerichts nach § 500 Abs 2 Z 3 ZPO (ob die ordentliche Revision nach § 502 Abs 1 ZPO zulässig ist oder nicht) nicht gebunden ist.
Die näheren Regelungen über die Kognitionsbefugnis des Verwaltungsgerichtshofs sind in dem nach Art 136 B-VG zu erlassenden Verfahrensgesetz zu regeln. Die Zulässigkeit der Revision wird durch die Abs 3 und 4 an die Zulassung durch das Verwaltungsgericht sowie an die im Abs 4 genannten Zulassungsgründe geknüpft. Für den Fall der Nichtzulassung ist ein Rechtsmittel (Nichtzulassungsbeschwerde) an den Verwaltungsgerichtshof vorgesehen. Im Hinblick auf das im Verwaltungsstrafverfahren geltende Verbot der „reformatio in peius“ erscheint die Einräumung einer Revisionsberechtigung an die belangte Behörde nicht sinnvoll. Zur Wahrung des objektiven Rechts unabhängig von der Strafhöhe besteht ohnedies auch im Verwaltungsstrafrecht eine Revisionsbefugnis der Landesregierung bzw des Bundesministers.
Die Zulassungsgründe entsprechen im Wesentlichen den Gründen für die Ablehnung einer Beschwerde durch den Verwaltungsgerichtshof nach dem geltenden Art 131 Abs 3 B-VG. Zu dieser Bestimmung wurde in der Literatur überwiegend die Meinung vertreten, dass sie mit den Anforderungen des Art 2 des 7. ZP zur EMRK in Konflikt stehe, weil dieser mit der Wendung „strafbare Handlungen geringfügiger Art“ auf die abstrakte Schwere des Delikts und daher auf die gesetzliche Strafdrohung abstelle (vgl zB Mayer, Die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern, in: Walter [Hrsg], Verfassungsänderungen 1988 [1989], 98 [102]). Um dieses Spannungsverhältnis zu entschärfen, stellt Abs 4 Z 2 nunmehr nicht auf die tatsächlich verhängte Geldstrafe, sondern auf die Strafdrohung ab.
Zu Abs 4 Z 1 wird bemerkt, dass bei der Frage, ob die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs nicht einheitlich beantwortet wird, zu berücksichtigen ist, ob die Uneinheitlichkeit tatsächlich auf denselben Rechtsvorschriften oder bloß auf ähnlichen Vorschriften verschiedener Länder beruht.
Zu Z 17 (Art 134)
Die Regelung orientiert sich weitgehend am geltenden Art 134 B-VG.
In Abs 1 wird statt der Bezeichnung „Räte“ die zeitgemäßere Bezeichnung „Richter“ für die sonstigen Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs und der Verwaltungsgerichte gewählt.
Gemäß den Abs 2 bis 4 erfolgt die Ernennung der Richter der Verwaltungsgerichte der Länder durch die Landesregierung, jene der Richter des Verwaltungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichts des Bundes erster Instanz durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung. Das Bestellungsverfahren für die Mitglieder der Verwaltungsgerichte entspricht im Übrigen im Wesentlichen jenem für die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs. Hinsichtlich der erforderlichen Berufserfahrung wird für die Mitglieder sämtlicher Verwaltungsgerichte zur Vermeidung von Schwierigkeiten der Rekrutierung von Richtern eine fünfjährige Berufserfahrung für ausreichend erachtet. Die Beteiligung von Berufsrichtern aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist – aufgrund der langjährigen positiven Erfahrungen beim VwGH – erwünscht und wird als Soll-Bestimmung – ohne nähere zahlenmäßige oder prozentuelle Konkretisierung (arg.: „womöglich“) – in die neue Verfassung aufgenommen, wobei als Vorbild Art 129b Abs 1 letzter Satz B-VG dient.
Die in den Abs 5 bis 7 enthaltenen Unvereinbarkeitsbestimmungen und die Regelungen über die Rechtsstellung der Mitglieder der Verwaltungsgerichte und des Verwaltungsgerichtshofs entsprechen der geltenden Rechtslage für den Verwaltungsgerichtshof. Die Mitglieder der Verwaltungsgerichte der Länder sind jedoch als „Bedienstete der Länder“ (Art 21 Abs 1 B-VG) Landesrichter.
Zu Z 18 (Art 135)
Die Abs 1 und 2 entsprechen von zwei Ausnahmen abgesehen dem geltenden Art 135 B-VG: Einerseits ist vorgesehen, dass die Verwaltungsgerichte grundsätzlich durch Einzelrichter entscheiden. Der Gesetzgeber, der zur Regelung der Einrichtung und des Aufgabenkreises des betreffenden Verwaltungsgerichts zuständig ist, soll jedoch abweichend davon für bestimmte Angelegenheiten die Entscheidung in Senaten vorsehen können. Andererseits soll anknüpfend an die bisherige Rechtslage für einzelne Unabhängige Verwaltungssenate statt der Vollversammlung des Verwaltungsgerichts ein von ihr gewähltes Organ zur Geschäftsverteilung berufen werden können.
Schon bisher war in Art 135 Abs 3 B-VG normiert, dass der Verwaltungsgerichtshof grundsätzlich in Senaten zu erkennen hat. Abweichend davon war jedoch in § 7 Abs 2 VwGG als Disziplinargericht die Vollversammlung des Gerichtshofs vorgesehen. Da einerseits an der Verfassungskonformität dieser Regelung Zweifel angemeldet wurden (vgl etwa Pichler, Personalsenat statt Vollversammlung?, Festschrift für Robert Walter [1991], 549 ff [555]) und andererseits die Vollversammlung als zu großer Spruchkörper erscheint, sollte ein eigener Disziplinarsenat beim Verwaltungsgerichtshof einfachgesetzlich vorgesehen werden.
Abs 3 wurde dem Art 87 Abs 3 B-VG angepasst und ermöglicht nunmehr die Abnahme von Sachen im Fall der unvorhergesehenen Überlastung eines Mitglieds.
Eine dem derzeit geltenden Art 135 Abs 4 B-VG korrespondierende Bestimmung konnte – aufgrund der nunmehr ausdrücklichen Regelung in Art 89 Abs 2 B-VG – entfallen.
Zu Z 19 (Art 136)
Art 136 B-VG weist dem Bund und den Ländern die Zuständigkeiten zur Regelung der näheren Bestimmungen über die Verwaltungsgerichte zu. Grundgedanke der Regelung ist, dass für alle Verwaltungsgerichte und für den Verwaltungsgerichtshof ein einheitliches Verfahrensgesetz des Bundes erlassen wird. In diesem Bundesgesetz sollen wesentliche Fragen, wie das Stattfinden und die Fälle des Unterbleibens einer mündlichen Verhandlung, die Frage des Neuerungsverbots, die Frage der Beschränkung der Verwaltungsgerichte auf Beschwerdepunkte etc, geregelt werden.
Neben diesem Verfahrensgesetz werden Bund und Länder eigene Gesetze über die Einrichtung und den Aufgabenkreis ihrer Verwaltungsgerichte zu erlassen haben. Wie bisher sollen diese gesetzlichen Regelungen durch Geschäftsordnungen der Verwaltungsgerichte und des Verwaltungsgerichtshofs ergänzt werden. Für die Mitglieder der Verwaltungsgerichte der Länder werden die Länder schließlich eigene dienstrechtliche Regelungen zu erlassen haben (wobei freilich auch auf die Möglichkeit einer Regelung im Sinne eines „dienstrechtlichen Homogenitätsprinzips“ oder überhaupt eines einheitliches Dienstrechts hingewiesen wird).
Zu
Z 20 (Überschrift vor Art 137)
Dadurch, dass einerseits eine neue Überschrift vor Art 129 B-VG eingefügt wird (vgl Z 10) und andererseits die bisherigen Überschriften A. bis C. vor Art 129a, vor Art 129c und vor Art 130 B-VG aufgehoben werden (vgl Z 12), lautet die Überschrift vor Art 137 B-VG nicht mehr – wie bisher – „D. Verfassungsgerichtshof“, sondern „B. Verfassungsgerichtshof“.
Zu Z 21 (Art 138 Abs 1 lit b) und Z 22 (Art 139 Abs 1
erster Satz)
Diese Neuerungen betreffen Anpassungen, die durch den Übergang von den Unabhängigen Verwaltungssenaten zu den Verwaltungsgerichten erforderlich werden. Nach dem neu konzipierten Art 138 Abs 1 lit b) B-VG soll für Zuständigkeitskonflikte innerhalb der Verwaltungsgerichtsbarkeit im weitesten Sinne (also einerseits zwischen Verwaltungsgerichten untereinander und andererseits zwischen den Verwaltungsgerichten und dem Verwaltungsgerichtshof) in Zukunft der Verwaltungsgerichtshof entscheidungsbefugt sein.
Zu Z 23 (Art 140 Abs 1 erster Satz)
Diese Neuerung betrifft Anpassungen, die durch den Übergang von den Unabhängigen Verwaltungssenaten zu den Verwaltungsgerichten erforderlich werden.
[An dieser Stelle wird noch einmal auf den unter Punkt III) abgedruckten Erstentwurf von Präsident Univ.-Prof. Dr. Jabloner und Univ.-Prof. DDr. Grabenwarter zum „Subsidiarantrag“ hingewiesen.]
Zu Z 24 (Art 144)
Die Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit und insbesondere die Einführung einer zweiten Instanz berühren notwendigerweise auch das Verhältnis der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Verfassungsgerichtsbarkeit. Nach dem vorliegenden Entwurf soll – mangels Konsenses über die Konzentration der Verwaltungsgerichtsbarkeit beim VwGH – das bestehende System und mit ihm die Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit weitgehend unangetastet bleiben.
Das bestehende System der Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit des Verfassungsgerichtshofs wirft das Problem auf, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vielfach noch kein Gericht entschieden hat, welches zur Vorlage im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Art 177 EGV berechtigt und verpflichtet wäre, und auch der Verfassungsgerichtshof selbst gegebenenfalls keine Entscheidungssituation vorfindet, die ihn zu einer Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften berechtigen und verpflichten würde (vgl VfGH 26.6.1997, B 877/96). Nach dem vorliegenden Entwurf entscheidet vor einer allfälligen Anrufung des Verfassungsgerichtshofs immer ein Verwaltungsgericht.
Zu Z 25 (Art 151 Abs 28)
[aus Zeitgründen noch nicht eingearbeitet]
Zu Punkt VI) 1): Zur Erweiterung des
Rechtsschutzes durch Beiräte und Rechtsschutzbeauftragte
Variante A.
Ursprünglicher Textvorschlag für die verfassungsrechtliche
Verankerung
von Rechtsschutzbeauftragten im 7. Hauptstück des B-VG
Art XY lautet:
„Artikel XY. Rechtsschutzbeauftragte, wie etwa jene nach der Strafprozessordnung, nach dem Sicherheitspolizeigesetz und nach dem Militärbefugnisgesetz, sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Sie unterliegen jedoch der Amtsverschwiegenheit.“
Erläuterungen:
Wie bereits im Allgemeinen Teil des Berichts dargelegt, war man sich im Ausschuss der verfassungsrechtlichen Problematik bewusst, die darin besteht, dass die Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit der Rechtsschutzbeauftragten nur einfachgesetzlich (in den §§ 149n Abs 4 Strafprozessordnung [StPO], 62a Abs 4 Sicherheitspolizeigesetz [SPG] und 57 Abs 3 Militärbefugnisgesetz [MBG]) garantiert sind, sodass das „Damoklesschwert“ der verfassungsgerichtlichen Kontrolle (und uU Aufhebung) ständig über ihnen schwebt.
Schon aus dem jüngst ergangenen Erkenntnis des VfGH vom 23.1.2004, G 363/02-13, ergibt sich die Notwendigkeit, dass allein aus Gründen der Klarheit und Rechtssicherheit die jetzt lediglich im einfachen Gesetzesrang stehenden, mehr oder weniger gleich lautenden Bestimmungen über die verschiedenen Rechtsschutzbeauftragten („Der Rechtsschutzbeauftragte ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Er unterliegt der Amtsverschwiegenheit.“) auf verfassungsrechtliche Ebene zu heben sind. In dem zitierten Erkenntnis hat der VfGH nämlich die Tätigkeit des Rechtsschutzbeauftragten nach dem MBG als „hoheitlich“ sowohl im materiellrechtlichen als auch im organisatorischen Sinn qualifiziert und einzelne Bestimmungen des MBG, darunter auch § 57 Abs 3 erster Satz MBG über den Rechtsschutzbeauftragten – mangels verfassungsrechtlicher Verankerung der Weisungsfreistellung bzw der Durchbrechung des in Art 20 Abs 1 B-VG angeordneten Weisungszusammenhangs – als verfassungswidrig aufgehoben.
Die anstehende Reform der Verfassung erscheint als ideale Gelegenheit und auch als richtiger Zeitpunkt für eine verfassungsrechtliche Absicherung der Rechtsschutzbeauftragten in Form einer unmittelbaren Anordnung im 7. Hauptstück des B-VG.
Variante B.
Textvorschlag Grabenwarter
Art XY lautet:
„Artikel XY. Durch Gesetz können Rechtsschutzbeauftragte eingerichtet und mit besonderen Aufgaben des Grundrechtsschutzes betraut werden. Sie unterliegen der Amtsverschwiegenheit, sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden.“
Erläuterungen:
Die unmittelbare Anordnung im ursprünglichen Entwurf sollte durch eine generelle Ermächtigung des Gesetzgebers ersetzt werden. Der Verweis auf einzelne einfachgesetzliche Grundlagen sollte nicht im Gesetz, sondern allenfalls in den Erläuterungen stehen.
Vorsitzender des Ausschusses 9: Univ.-Prof. Dr. Herbert Haller e.h. 26. März 2004